Elke Erb: Gutachten
DIE DICHTER WOHNEN IN DEN JAHRHUNDERTEN
Die Dichter wohnen in den Jahrhunderten,
Dieser in jenem, jener in diesem, einer lappt über,
Der andere mittendrin wie der andere, der auch
aaaaamittendrin wohnt
Schön und gut. Endler erstreckt sich von 30 bis 90 in
aaaaaseinem.
Sonst wohnen auch die Dichter in Wohnungen wie dieser,
Die z.B. der Endler besitzt, Quartierchen fünfter Stock,
Badlos, Hinterhaus, Außenklo, aber mit Sonne.
Wenn der Dichter Endler seinen Kopf zum Fenster rausstreckt,
Sieht er nach, ob die Müllkübel leer sind.
Nachsatz
Wiepersdorf siebter Abend
I
Ich sitze im Schloß – Edi und Elke
In ihrer Mühle. Abends
Haben sie und auch ich
Diese verstiegenen Falter
Seltsamer Farbe und Zeichnung
In unsern Räumen. Ich liege
Auf einem Biedermeiersofa, Edi
Gewiß auf dem Feld-Bett, die älteren Dichter
Wälzend und prüfend. Und Elke
Geht mit ihren verblichenen Schuhen
Noch um das Haus. Da sieht sie
Heute der Sperber an, da denkt sie
An mich hier in diesem
Volkseignem Schloß wo private
Unken Kummer mir vorschrein.
II
… Das Nachwort für Elke ist noch immer nicht fertig. Je öfter ich die Texte las, desto schwerer erschien mir die Absicht, und nun meine ich, daß ein überragendes Buch keines Nachworts bedarf. Leider zeichnet sich die Reihe, in der dieser Band erscheint, durch längere und kürzere Nachworte aus. Und wenn ich dem Verlag nicht endlich eins schicke, verspätet sich die schöne Erscheinung. So muß ich mich schnell daranmachen, eigentlich aus der hölzernen Wanne heraus, in der ich hier meistens sitze, und weshalb mir auch Schwimmhäute wachsen. Ich kann dieses Buch den Lesern nur empfehlen, und ihnen versichern, daß sie eines erworben haben, das berühmt werden wird. Könnte ich schreiben. Oder ich lasse Elke einfach nachts mit dem Maler Bachmann übers schroffe Gebürge gehen, den Kaufvertrag vom Mühlengrundstück fix und fertig in der Tasche, Sturm in Saus und Braus. Anderntags bringt er von den wendischen Schrottplätzen merkwürdige Dinge, auch eine alte Küchenwaage, in goldenen Löwenköpfen die Zünglein.
Du bedaure mich bei meiner schwierigen, nutzlosen Unternehmung, den schönen Stücken was beizufügen. Ich sehe uns in der Rheinsberger Straße, um den schwarzen Tisch sitzen, jeder einer der vier Winde, und Elke liest die Geschichte vom Feuermal. Nun sind wir zerstreut, jeder in eine andere Richtung, aber nur vorläufig.
Sarah Kirsch, Nachwort, Mai 1974
Beiträge zu diesem Buch:
Jan Albrecht: Elke Erb: Gutachten
Sonntag, Heft 3, 1976
N. N.: Das Debüt
Berliner Rundfunk, 7.3.1976
Renata Berg-Pan:
World Literature Today, Heft 4, 1977
J. S. G.: Poesie und Prosa
Die Weltbühne, 17.10.1976
Beginnen, gewinnen
AUF M.
Das Labyrinth in Schutt
Der Schuttberg Labyrinth
Gekichert ist geschluchzt
Wer klagt frißt Wind.
(aus der Anfangszeit, ungedruckt)
Es tat mir nicht gut, in meinen Notizbüchern zu lesen. Wieder war das Grauen vor aller Vergangenheit, aller Verfehlung da.
Gehe ich in der Zeit zurück, bis dorthin, wo es noch keine gedruckten Texte von mir gab, in die Zeit meiner ersten Schreibversuche, wird aus dem ,wieder‘ (,wieder war das Grauen da‘) ein ,immer wieder‘:
Ein in die Flucht treibendes Grauen immer wieder, ein panisches Grauen jedesmal, und nach 14 Tagen schon, beim Lesen, nach einem jeden dieser Versuche, ihnen also fast auf dem Fuße folgend, jedesmal, immer wieder.
Die Lebenszeit dieser kurzen Proben wurde mit der Zeit länger. Ich gewann einen Spielraum für die Arbeit, in welchem das Grauen sich bis zum Verwerfen mildern konnte (!), oder, wenn ein Text nicht verwerflich schien, in ein zähes Bemühen verwandelt war (!), diesen überlebenden Lebensreiz der Notiz zu retten.
Erst nach etwa zehn Jahren entstand der erste nicht mehr grauenerregende Text, der die Reihe der anderen aber nicht etwa abbrach, sondern sich absonderte, einfand in einer Sammlung von 30 ,Proben‘, die es miteinander unternahmen, ein Manuskript zu werden.
Einen von ihnen verdrängte er. Auch diese 30 hatten die Reihen der anderen gelichtet, und mit ihrem Manuskript war es so, daß die bisher dauerhaftesten von noch dauerhafteren neuen verdrängt wurden, immer ein neuer dort einen älteren fortschob.
Ich lernte, Wortfolgen, die mich vordem gegraut hätten, – fühllos gegen das Grauen, mit Geduld, als überwindbare Fehler anzusehen, als Stellen, die nicht ,durch‘ waren (jedes ihr Durchgekommensein war mein Durchgekommensein).
Ich erschloß das Verfehlen nicht. Ich umging, vermied, überlistete es. Es entstand kein Wissen, das dem Grauen hätte erwidern, standhalten können, kein Wissen, so unwiderleglich, wie das Grauen spricht. Kein Bewußtsein.
Unerschlossen, dem Bewußtsein verschlossen, blieb das Gelingen wie das Verfehlen. Ich habe ebensowenig von mir selbst wie von anderen lernen können.
Nur wenige Texte von anderen habe ich in einem fühlbaren Kontakt zu meinem eigenen Schreiben gelesen:
Boris Pasternak. Ihn hatte ich nicht gelesen, sondern übersetzt: ein paar Seiten aus seinem „Schutzbrief“, im Sommer ’67 – Wie er dem Wirkenden – Individualität zuerkannte, es zum Subjekt seiner Sätze machte, welche ich, weil ihnen die gewohnte Art von Subjekt fehlte, verblüfft ,kopflose Sätze‘ nannte, war eine bestärkende Offenbarung für mich.
Marina Zwetajewa: Auch sie habe ich nicht gelesen, sondern übersetzt: 40 Seiten Prosa, „Puschkin und Pugatschow“. – Die Arbeit währte ein Dreivierteljahr. Sie war mein Gesellenstück. – Das Beharrende der Wendungen, das beharrend Eindringende, die rückhaltlose Gleichheit (nicht etwa nur Einhelligkeit) der Bewegung der Schreibenden – mit der Sprache, und zugleich (und dennoch, und deshalb) das absolut Instrumentäre ihres Wortlauts (ein Pflug im Acker?).
Sie ist die einzige, von der ich in meiner eigenen Schreib-Sprache einmal etwas wiedererkannte, wieder traf (verwirrt, verlegen: das ist doch sie!) – während ich sprach.
Robert Walser entzückte mich beim ersten Lesen mit seiner Geschmeidigkeit. Wie mir jetzt klarer vor Augen tritt, war der Grund der Begeisterung, Walsers Effekt: daß er mir vorspielte, wie ein Thema von seinem Feld her sprach, und mir, die einen Weg durch die Unwirklichkeit und aus der Unwirklichkeit suchte, das Vorspiel einer zauberischen Hörigkeit, Gehörigkeit und Zusammengehörigkeit des sprachlichen Logos gab.
Der vierte ist Konrad Weiß, seine leidenschaftliche, vehemente deutsche Prosa (ich fand eine Probe von ihr in einer Zeitschrift) schien die entselbstende und entwirklichende Prosa des Nachfahren-Deutsch (und das meine hatte die Katastrophe des Nazismus in den Knochen!) nicht zu spüren. Sie ließ unterschwellige Wahrnehmungen, unterbewußte Wirkungen aufleuchten im Bewußtsein und verwob, verband, vereinigte sie zu einem nie erlebten unmittelbarer Fluten.
Ich habe die vier in der Reihenfolge genannt, in der ich mit ihnen bekannt geworden bin. Ich habe sie als Leserin gelesen trotz allem, nicht als Autorin (!).
Ich hatte keine bewußte Arbeitserfahrung. Erfahren – als irfaran – ist durchwandern. Also: Eins nach dem anderen. Additiv, nicht potenziert / (wie es der Vorwitz, die Gier des Fortschritts will).
Durch alles mit allem, nicht nur mit dem Bewußtsein.
Ich graute mich nicht vor dem Grauen. Es war einfach nicht da, wenn es nicht da war. Leichtsinn? Verdrängung? Das Gute von beidem.
Denn wie – ohne Leichtsinn – hätte ich zu schreiben beginnen können. Zu gewinnen glauben können jedesmal wieder, wo jedesmal wieder das Grauen an die Stelle jeden geglaubten Gewinns trat? Da es – wie ein Hohn – jeden vermeinten Gewinn tilgte, ihn nicht gelten ließ, wie hätte es mich gelten lassen können?
Bewußtlos, erfahrungslos. Leichtsinn, Hochmut. Hochgemut nie wurde der tödliche Grund bebaut.
Wir kamen ja aus. Ich gewann ja den Spielraum, er wurde ja größer. Ich hatte zu tun.
Ich vertrieb das Verfehlen, nicht das Grauen. Es blieb ja. Draußen. Bei dem Verfehlten.
Aber ich wollte nach draußen, das weiß ich. Denn als ich mein erstes Bändchen zusammenstellte, überraschte mich dieses Streben als ein seinen Texten gemeinsamer Zug: Sie sind alle nach draußen gerichtet, empfand ich.
„Draußen“ hätte ich den Band nennen können, statt „Gutachten“.
Nachzusetzen wäre noch ein späteres Fazit: Jeder Fehler war eine Bleibe, nämlich ein Kerker. / Jede Bleibe war – ein Fehler, nämlich ein Kerker.
Elke Erb, aus: Renatus Deckert (Hrsg.): Das erste Buch, Suhrkamp Verlag, 2007
Zu den Versen und der lyrischen Prosa von Elke Erb
− Der nebenstehende Text wurde als Verlagsgutachten verfaßt. −
Das Gedicht „Wie doch, als wir schliefen…“ ist vielleicht das schönste Stück der Anthologie Auswahl 68 (Verlag Neues Leben). Wie da Traum, Traumbild (wie riesige Rose) und einfache Wirklichkeit (zwei fallende Äpfel) ineinander verwoben sind – das stellt ziemlich genau diese Atmosphäre dar zwischen geträumter Abwesenheit und bewußter Anwesenheit, die jeder kennt und die so schwer zu treffen ist; wenn man sie schreiben will. Das Gedicht schlägt aus der sicheren Konstatierung ständig in die große Vision (Rose und Meduse sind da eigentlich keine künstlichen Zutaten); die eine Momentszene erst bedeutend, weil deutlich macht, ihr aber nie die persönliche Geste nimmt, daß sie zugeich wahrhaft lebendig bleibt. So etwas wird nur selten in einem Gedicht erreicht. Es ist für mich zwar nach: „So schliefen wir aus und erwachten“ zu Ende, denn die folgende Replik ist schon eine Spur zu bewußt auf Aussage hin forciert – aber das stört nicht die Wirkung dieses ja in seinem Symbolwert wichtigen Gedichts, das ich nicht nach seinem Vorhaben hin zu interpretieren brauche. Man könnte allerdings bei einer Interpretation gern Zeit darauf verwenden, wie, durch eine intuitive oder sehr kunstbewußte (wer will das da unterscheiden?) Überblendung, Möglichkeiten der Überschneidung von Raum und Zeit erfolgen, die uns wohl erst in neuester Zeit so möglich zu vollziehen sind. Man empfindet das Gedicht auch von daher im besten Sinne als ,modern‘ – ein Wort, vor dem man ja keine Angst zu haben braucht, weil es nur ausdrückt, was an Errungenschaften zur Zeit möglich ist.
Alle diese Züge, hier in einem Gedicht schon vollendet vorgeführt, finden sich mehr oder weniger ausgeprägt auch in den anderen Arbeiten von Elke Erb wieder, die damit neben Inge Müller und Sarah Kirsch als wesentliche Lyrikerin ihren Platz in unserer Literatur hat. Mit ihnen ist – auf sehr verschiedene aber irgendwie verwandte Weise – etwas in unsere Lyrik gekommen, was sie bis dahin kaum hatte: die Fähigkeit, in den bewußten Versen etwas Traumhaftes, Un- oder Vorbewußtes miteinfließen zu lassen (nicht durch Erinnerung wie bei Bobrowski oder durch Bildung und Montage wie bei Mickel); das uns durch seine Unmittelbarkeit von dem Prozeß vermittelt, der im Lyriker beim Verseschreiben vor sich geht: spontanes Empfinden. Früher hat man das manchmal auch Gesichte genannt, eine traumhaft sichere Phantasie, die bruchstückhaft vorwegnimmt oder nachholt in Gefühl und Ahnung, was erst später vernunftmäßig deutlich wird. Nennen wir es: mit dem inneren Auge sehen. Denn natürlich werden auch Vorgänge ausgedrückt, die schon zuvor gedacht waren, aber die Verse haben nicht den Stempel der Gedankenblässe. Wenn in der Lyrik unserer jüngeren Leute oft stört, daß sie ihr ideologisches Programm so sichtbar gelenkt vor unseren Augen drapieren (sei es durch Landschaft oder Liebe), so also in Erlebnishälfte und Absicht zerfallen lassen, so kommt das hier gar nicht auf, weil das Gedicht von einem spürbaren Gefühl, einer Atmosphäre getragen scheint. Das kann natürlich manchmal dazu führen, daß es an letzter logischer Konkretheit fehlt – aber selbst das nimmt man in Kauf, da uns die Bild-Logik besser überzeugt, als ein schlecht verkleidetes Argument.
Damit ist grundsätzlich schon einiges zu den hier vorliegenden Arbeiten gesagt. Sicher kann Elke Erb ihre Anlagen in den in letzter Zeit in Anthologien publizierten Gedichten am glücklichsten realisieren: „Das Flachland vor Leipzig“, „In dem Sommer“, „Vorstadt-Begräbnis“, „Porträt A. E.“ (es variiert sehr original den Satz Mickels aus Dresdner Häuser: „Ich selber will ein Haus sein…“), „Ein Lamm weidete…“, „Ehe du herkommst…“ Man könnte aus diesem Manuskript dazu stellen: „Georg, du siehst…“, „Mutter, du mußt gegangen sein…“, „Tod, Erdbeere“, „Wie ein Fluß…“ (ähnlich die Beziehung zwischen einem Gegenstand und Person wie bei dem Haus in „Porträt A. E.“) Traum, und bestechend durch Knappheit: „Papierdrachen“ und „Rosenbaum“. Das sind alles meist kürzere Gedichte, die mehr oder weniger von einem poetischen Einfall leben, während die größeren ein Motiv mit dem anderen verweben. Vielleicht ist diese Fähigkeit, das Motiv zum Komplex auszuweiten erst in den Gedichten seit 1966 spürbar.
In den früheren „Doch da du blind bist“ und „Licht vor den Blöcken“ wird eigentlich nur eine Stimmung mehr oder weniger halluzinatorisch durchgehalten. Man hat etwas das Gefühl des Künstlichen, weil die Realien allgemein erscheinen und nicht spürbar von ganz subjektiven Einfällen getragen werden. Zu weit weg von wirklich nachspürbaren Beziehungen ist auch das Gedicht „Abrede“ (67), es führt Haltepunkte zu fragmentarisch ein, man wird nicht in den Bann des Bildes, der poetischen Vorgänge gezogen. Vielleicht ist an diesen Gedichten noch weiter zu arbeiten, das gilt auch für „Montag: Vögel…“ und „Straßenbahn“ – da ist mir einfach zu wenig da.
Manchmal behilft sich die Autorin auch mit volksliedhaften Motiven („Die Lilien auf dem Felde“) und stilisiert sie mit guter Einfühlung, aber man wird da den Eindruck des Angelesenen nicht ganz los. Vielleicht behagen mir die ausgesprochenen ,Einfälle‘: „Anpassung“, „Die Epigonenuhr“, „Die Straßenbahn“ (Grandseigneur…) bisher am wenigsten, weil sie sich auf die sprachliche Floskel verlassen, die man dann abnehmen kann oder nicht. So witzig ist das nicht. Wenn ich die lyrischen Prosa-Stücke gesondert von den Versen betrachte, so nur, um sie deutlicher abzuheben. Sie stehen in sehr engem Kontakt zu den Versen, das Prosaische ist mehr Attribut denn Ausgangssituation, es wird da nichts erzählt. Hingegen tritt die somnambule Atmosphäre in den Vordergrund – das sind eigentlich durchweg fast Traumszenen, in surreale Bereiche gesteigerte Vorgänge.
„Das macht das Gehen“ erscheint noch mehr als Versuch dazu. „Wir haben in dem großen Saal einen Ofen“ steigert die Beschreibung schon in das Ding Ofen so hinein, daß er die Szenerie beherrscht. Natürlich hat sie parabelhafte Züge, wenn auch mehr parabolisch für eine erfühlte Situation, nicht für einen Prozeß, wie in „November“ oder zu bewußter Aussage hin gesteigert in „Berliner Winter 67“, wo die Szene schon für etwas Größeres steht. Manches liest sich wie ein freundlicher Kafka: „Am Tage der Heiligen drei Könige“ – man weiß nicht, wo und wann das spielt und die Verallgemeinerungen sind ein bißehen nebulös („so recht wir Menschenkinder“), wenn auch für meinen Geschmack durchaus in einer freundlichen Ironie dazu aufgehoben. Aber da ist Raum für entsprechende Einwände andererseits, sie sollten nicht möglich sein, wenn das Manuskript abgeschlossen und komponiert erscheint.
Ich glaube, daß Elke Erb da ihre Möglichkeiten auch noch zu wenig nutzt, irreale Geschichten zu erzählen, die etwas sehr Reales meinen. Vielleicht kann sogar an„ Orthodoxe Admonition…“ noch etwas getan werden? Die wirkungsvollsten Beziehungen zwischen der hübschen Weißfischgeschichte und den montierten historischen Daten sind wohl noch nicht gefunden, mir gehen sie jedenfalls noch nicht recht auf. Es wäre gut, wenn zwischen Versen und lyrischer Prosa in der Komposition des ganzen dann auch Beziehungen hergestellt würden. Damit scheint durchaus der Grund gelegt für einen Lyrik-Band, dem man nur wünscht, daß er sich bald weiter anreichert, auch durch weitere größere Gedichte. Elke Erb beherrscht das knappe Bild in knappen Versen, auch das sinnreich verwobene, sich vor unseren Augen total entfaltende lyrische Gebilde.
Sie sagt deutlich, was sie heute und hier bewegt – nicht mit den üblichen Worten, nicht in der üblichen Konfrontation zu Tagesvorgängen – aber in der Aufnahme von Zeit-Szenen und Zeit-Geschehen, durchaus von dieser Wirklichkeit bei Leipzig oder in einem Haus unserer Städte. Das wünscht man sich ausgeführt, ohne demonstrierende Zutat, aber auch nicht verschwommen in wiederum allgemeiner Ausspinnerei („Es ist nicht so, daß die Landschaften…“ spielt mir zu sehr mit Begriffen wie ,Zeit‘ – ,Lüge‘ – ,Angst‘, als daß sie recht lebendig würde).
Niemand wird die eigene Handschrift vermissen, man wünscht sie weiter ausgeschrieben und ausgebildet.
Gez. G. Wolf, 5.4.1969
Richard A. Zipster: DDR-Literatur im Tauwetter. Band III. Stellungnahmen
Gedichtverdachte: Zum Werk Elke Erbs. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung In den Vordergrund sprechen Hendrik Jackson, Steffen Popp, Monika Rinck und Saskia Warzecha über Elke Erbs Werk.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Franz Hofner: Hinter der Scheibe. Notizen zu Elke Erb
Elke Erbs Dankesrede zur Verleihung des Roswitha-Preises 2012.
Elke Erb: Die irdische Seele (Ein schriftlich geführtes Interview)
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Elke Erb und Friederike Mayröcker.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Elke Erb liest und diskutiert am 19.11.2013 in der literaturWERKstatt berlin mit Steffen Popp.
Lesung von Elke Erb zur Buchmesse 2014
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Steffen Popp: Elke Erb zum Siebzigsten Geburtstag
literaturkritik.de
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Waltraud Schwab: Mit den Gedanken fliegen
taz, 10.2.2018
Olga Martynova: Kastanienallee 30, nachmittags halb fünf
Süddeutsche Zeitung, 15.2.2018
Michael Braun: Da kamen Kram-Gedanken
Badische Zeitung, 17.2.2018
Michael Braun: Die Königin des poetischen Eigensinns
Die Zeit, 18.2.2018
Karin Großmann: Und ich sitze und halte still
Sächsische Zeitung, 17.2.2018
Christian Eger: Dichterin aus Halle – Wie Literatur und Sprache Lebensimpulse für Elke Erb wurden
Mitteldeutsche Zeitung, 17.2.2018
Ilma Rakusa: Mensch sein, im Wort sein
Neue Zürcher Zeitung, 18.2.2018
Oleg Jurjew: Elke Erb: Bis die Sprache ihr Okay gibt
Die Furche, 8.3.2018
Annett Gröschner: Gebt Elke Erb endlich den Georg-Büchner-Preis!
piqd.de, 27.6.2017
Zum Georg-Büchner-Preis an Elke Erb: FR 1 & 2 + MOZ + StZ + SZ +
Echo + Welt + WAZ + BR24 + TTB + MAZ + FAZ 1 & 2 + TS + DP +
rbb +taz 1 & 2 + NZZ +mdr 1 & 2 + Zeit + JW + SZ 1 & 2 +
Zur Georg-Büchner-Preis-Verleihung an Elke Erb: BaZ + BZ + StZ +
AZ + FAZ + SZ
Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2020 an Elke Erb am 31.10.2020 im Staatstheater Darmstadt.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Archiv +
Internet Archive + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: FAZ ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ taz ✝︎ MZ ✝︎
nd ✝︎ SZ ✝︎ Die Zeit ✝︎ signaturen ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ literaturkritik ✝︎
mdr ✝︎ LiteraturLand ✝︎ junge Welt ✝︎ faustkultur ✝︎ tagtigall ✝︎
Volksbühne ✝︎ Bundespräsident ✝︎
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.
Keine Antworten : Elke Erb: Gutachten”
Trackbacks/Pingbacks
- Elke Erb: Gutachten - […] Klick voraus […]



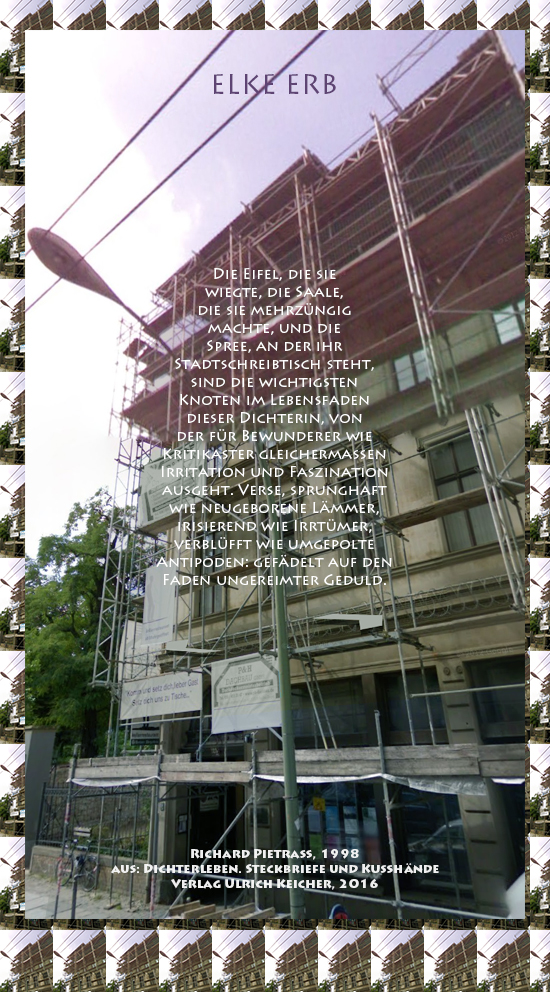












Schreibe einen Kommentar