Gerhard Falkner: X-te Person Einzahl
GEDICHT OHNE WORTE
ein Wortwitz wars erst, eine Mauschelpfütze
ein kugelblitzartiges Kalauern der Seele
über der Bewunderungspfalz
ein herbeiorakeltes, leichtentflammbares
Geständnis im Ungegengeständnis
da hat die womit man redet gekalbt, mitten
in die von Eignen gewölbte Welt, da hat
sich in diesem Herrgottswinkel bei Schongau
die Ewigkeit geschneuzt ins Schweißtuch
des Pfalzgrafen / des Dichters
und seit den Tagen Pindars ist keine
Vorzugsausgabe des Lichts
mehr über eine solche Pfütze geglitten
Gerhard Falkner
hat zwischen 1981 und 1989 drei Lyrikbände veröffentlicht: so beginnen am körper die tage; der atem unter der erde und wemut. In Abkehr von der neonkonkreten Alltagspoetik der siebziger Jahre und in Anknüpfung an die Werke der internationalen Lyrikmoderne ging Gerhard Falkner seinen eigensinnigen Weg – „meine zunge spielt verrückt mit meiner muttersprache“.
Gerhard Falkners Poesie, in der sich „Bibliomanie mit einem heftigen Alltagsgenuß vereint“ (Erk Grimm), entfaltete sich trotz rühmender Stimmen abseits der Öffentlichkeit; der Autor trat rigoros hinter seine Lyrik zurück und entschloß sich Ende der 80er Jahre, seinem „sprachkraftwerk“ Dichtung ein Ende zu setzen. Diesen Entschluß hat Gerhard Falkner eingeschränkt und an seinem die deutschsprachige Gegenwartslyrik bereichernden Werk weitergeschrieben. Sein neues Buch mit dem programmatischen Titel X-te Person Einzahl umfaßt die teilweise revidierten Extrakte seiner früheren Werke und neueste Gedichte bis zum Jahr 1996.
Suhrkamp Verlag, Klappentext 1996
Vom Ich zum X
− Das lyrische Werk von Gerhard Falkner. −
1989 hat Gerhard Falkner (geb. 1951) mit wemut seinen dritten und – wie er damals nicht ohne Pathos ankündigte – letzten Gedichtband veröffentlicht. Wenn jetzt neuerdings Gedichte von ihm erscheinen, so ist das kein Widerruf. Denn es handelt sich hier um eine Art Summa, die zur Hauptsache Extrakte der drei Gedichtbände (zum Teil revidiert) oder zerstreut Gedrucktes umfasst.
„Müttergenesungswerk“
Der Titel X-te Person Einzahl ist mehr als ein witziger Einfall. Zunächst einmal scheint er eine provokante Absage an das traditionelle „lyrische Ich“ zu sein, auf das Falkner schon früh nicht gut zu sprechen war. So etwa schreibt er in seinen 1993 unter dem Titel „Über den Unwert des Gedichts“ veröffentlichten „Fragmenten und Reflexionen“: „Für das ,lyrische Ich‘ wird’s langsam mal Zeit fürs Müttergenesungswerk.“ Ein Spott, dem die Kränkung anzumerken ist, die diesem Ich offenbar zugefügt worden ist und das sich nun nolens volens hinter der „X-ten Person Einzahl“ verschanzt. Sieht man einmal von diesem Ich-Versteck mit seiner unverhohlenen Kreuzessymbolik ab, dann kann die „X-te Person“ durch x-beliebige andere Personen in „Einzahl“ ersetzt werden.
Der folgende Gedichttitel scheint das zu bestätigen: „Das Einzigartige als beliebige Folge von Austauschbarkeiten“. Wie man sich das konkret vorzustellen hat, führt das Gedicht anschliessend auf inhaltlicher wie lautlicher Ebene vor. Indem Falkner nun seine Summa einer zugleich einzigartigen als auch austauschbaren Person zuschreibt, verrät er die extreme Gespanntheit, aus der sein „sprachkraftwerk“ hervorgeht. Denn vom Ich zum X ist lautlich zwar nur ein winziger, inhaltlich aber ein sehr weiter Schritt. Das Gedicht „alle worte sind schuldig“ reflektiert ausführlich diesen komplexen Sachverhalt:
das ich der vielen, die wir waren, bevor
es uns zerknüllte zu diesem einen
das wir sind und nicht sind.
Die klangliche Nähe von Ich und X zeigt ausserdem, dass von der programmatischen Austauschbarkeit nicht bloss die Person des Autors, sondern vor allem auch das Wortmaterial betroffen ist. Letzteres spielt in Falkners Lyrik eine enorme, gelegentlich penetrante Rolle. Daran ist er aber nicht allein schuld, sondern auch die an Dichtern wie Falkner geschulte Werbung, die bald an jeder Plakatwand Verballhornungen wie „herzzeitlose“, „selbstbesichtigung“, „aschenkaputtel“, „lichtraucher“ oder „feindschmeckerin“ zum besten gibt. Das wirkt sich aus wie ein Bumerang: was vor Jahren unter Umständen sprachschöpferisch war, klingt heute bemüht.
Philosophischer Hochseilakt
Natürlich beschränkt sich ein Lyriker wie Falkner, der sich auch sprachtheoretisch in schwindelerregende Höhen geschraubt hat, nicht auf die simple Austauschtechnik des Werbeslogans. In dem sechsteiligen Zyklus „materien“, einer mit verschiedenen Schrifttypen und getrennten Kolumnen arbeitenden Textmontage, führt er typographisch vor, was ein aus „wortbrüchen“ bestehender „textspeicher“ sein kann. Auch der letzte Text dieser Sammlung („ich sage null für ja und eins für nein“), ein fünfseitiger, mit Ein- und Dreizeilern, Wiederholungen und Variationen jonglierender Monolog, demonstriert – nur scheinbar paradox – eine Vielstimmigkeit, an der sich genau studieren lässt, was mit dem Sprechen in der „X-ten Person Einzahl“ gemeint sein könnte. Ein sehr schwieriger, im Grunde philosophischer Hochseilakt, der ein weiteres Mal den ausserordentlichen (Selbst-)Anspruch eines Dichters vorführt, der von sich sagt, dass er der „kühnsten unter den Künsten“ verfallen sei. Wir glauben es ihm und seiner seit Beginn durchgehaltenen „haute écriture“ aufs Wort.
Charitas Jenny-Ebeling, Neue Zürcher Zeitung
Auserloren in der gegenwalt
− Kommoden aller Epochen bewahrt Falkners X-te Person Einzahl. −
Ende der 80er Jahre entzog Gerhard Falkner sein „Sprachkraftwerk“ Dichtung der Öffentlichkeit. „Öffentlichkeit bedeutet Gewaltanwendung“ schrieb er 1993 in seinen Aufzeichnungen Über den Unwert des Gedicht. Es war die endgültige Verweigerung des Dichters, „aus dem wortschatz land (zu) verkaufen“: „Der Dichter stirbt aus, weil eine in Pleonexie (Überfluß, d. Red.) verrottende Gesellschaft seine Existenzbedingungen zerstört, die nämlich der Verfeinertheit, eines Gewissens des Ohrs, der Zeit (Muse) für rhythmische Wiederholung, aller Arten von Herzensgüte, Noblesse und Unterscheidungsfähigkeit. Man fordert vom Gedicht zunehmend den plakativen Griff, wie ihn die Werbung tut. Wenn sich das Gedicht darauf einläßt, wird es seinen Schwerpunkt ebenso verlieren wie die Werbung ihren Zusammenhang mit ihrem Gegenstand.“ Nach siebenjährigem Innehalten erscheint nun in der edition suhrkamp ein neuer Gedichtband Falkners unter dem Titel Xte Person Einzahl mit neuen Gedichten, vor allem aber mit Destillaten seiner früheren Lyrikbände.
Vor einer Verantwortung (und sei es der gegenüber Sprache) vermag sich mancher Zeitgenosse, wenn auch unter Gewissensbissen, davonzustehlen. Wenn jedoch ein Werk von seinem Urheber sagt, er „ist ohne mich verloren, denn ich bin sein gedicht“, wird begreiflich, warum er das Versprechen, seiner Dichtung ein Ende zu setzen, nicht vollends einlösen kann. Da er der „gegenwalt“ standhalten muß, bleibt ihm nur die Wahl seiner eigenen Mittel. Er muß zwangshaft gegen eine „Vorstellung von Sprache“, die „im allgemeine so lausig, wie es ein Blick auf die Uhr als Begriff von der Zeit ist“. Denn die „Sprache ist das Licht, das von uns heraus auf die Dinge fällt“.
Sprache ist demnach eine hoch infektiöse Angelegenheit. Kein noch so ausgeprägter Schutzmechanismus, keine der noch so zahlreichen Antikörper bewahren vor einer immer wieder auftretenden Ansteckung durch dieses sich chamäleonhaft wandelnde Etwas, welches das Sein durchdringt wie ein Laserstrahl dichtes Gewebe.
Xte Person Einzahl scheint ein Widerspruch zunächst allein der Menge, eine Widerrufung der deutschen Grammatik. Der tiefere Grund für die Flucht hinter das Kreuz (das zu tragen der Dichter bereit ist). Ichduersiees sind zu belastet, als daß sie noch in den Zeugenstand treten könnten. Ihre Authentizität ist so echt wie die Nachrichten bei errteellsatteins oder wie war der Name? Alle und alles sind unverwechselbar beliebig geworden. Ich läßt sich durch du, er durch es vertreten, und keiner scheint davon Notiz zu nehmen oder sich sogar einen Reim darauf zu machen bis auf wenige Ausnahmen. Auch eine Mehrzahl bietet keine verläßliche Gesellschaft mehr, wie überhaupt das Wir nur als Fiktion (Gemein)Sinn stiften mußte, ohne daß es je nachweisbar existiert hätte.
gesichter aber:
absolutes parterre
gebaut wie cockpits
im absturz der jahre zerstört.
Kein Schutz durch Menge. Insofern ist die EinZahl die einzig verläßliche Größe, die noch zählt. Sie läßt sich weder ersetzen noch vertreten. Denn sie ist einsam, und diese „auserlorenheit“ ist kein Tauschwert.
Wer Falkners „sprachsperrbezirk“ zu übertreten gewillt ist, den erwartet das „jüngste gedicht“. Die Schranken schließen sich, sobald man die erste Seite aufgeschlagen hat, und man findet sich wieder inmitten eines magischen Zirkels aus Sprache. Man „möchte sich entfernen / aber alles ist so in seine nähe / gerückt daß kein auskommen ist“. Falkner geht mit dem Fundus der Wörter wie ein behutsamer Restaurator und kühner Architekt gleichermaßen um. Er bewahrt Kommoden, Schränke, Zierat aller Epochen. Er bearbeitet, verbaut das Wortmaterial zu neuen Behausungen, setzt Erker, Skulpturen, Fluchten in die Landschaft. Ein wahnsinniger Lenne des verwilderten Wörtergartens. (Das Wort wahnsinnig beschwert kein pejoratives Gewicht: WahnSinn bedeutet die Gabe, durch schmerzhaft offene Sinne klar wahr Nehmen zu können.) „Absicht des Gedicht ist es, die Sprache zu sich kommen zu lassen und sich des Dichters für diesen Vorgang zu bedienen.“
Cornelia Jentzsch, Berliner Zeitung, 8.2.1997
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Thomas Kraft: Kein Stein schwirrt auf Geheiß
Süddeutsche Zeitung, 7./8.9.1996
Falkners Falter
Mitte der 1990er Jahre strapazierte ich die Geduld meiner Berliner Mitbewohner, indem ich an den freien Wänden, im Hausflur, in der Küche, in der Duschecke, Zettel mit Gedichten aufhängte – nicht mit eigenen, wohlgemerkt, sondern mit solchen, die mir gefielen, die ich abgeschrieben und ausgedruckt hatte. Wer sich nachts, in einem hässlichen Berliner Winter, auf den Weg zu unserer Außentoilette eine halbe Treppe tiefer machte, verschlafen die Tür schloss und das Licht anknipste, sah sie auch dort, leicht bewegt im eisigen Wind, der durchs undichte Fenster drang, zitternd auf dem bröckelnden Putz wie große, bleiche Falter.
Dichter aus aller Welt fanden sich auf meinen Zetteln wieder, ob sie wollten oder nicht, Amichai und Gustafsson, Heaney und Hughes, Simic und Tranströmer, und auch Gerhard Falkner war mit Gedichten vertreten. Von mindestens zweien weiß ich dies ganz sicher: Von „patio de las aranjas“ mit seinen sinnlichen Bildern, dem roten Orangenorchester und dem abschließenden, starken Akzent des Pfaus, der vorm Fenster die Hässlichkeit seiner Füße beklagt und aufschreit – und von jenem titellosen Liebesgedicht mit zwei Strophen zu jeweils fünf Zeilen aus der Auswahl „X-te Person Einzahl, das schon 1981 in Falkners erstem Gedichtband so beginnen am körper die tage abgedruckt worden war. Ein Gedicht mit ruhigen, ja geradezu provozierend harmonischen Jamben, ein Liebesgedicht überdies, das am hohen Ton und an den gefährlich großen Worten nicht sparte, sondern sich ihrer selbstgewiss bediente – „ich bin die welt / bedrückt von deinem schlaf, bin die gefahr / die leise deinen traum in atem hält“. War das überhaupt zulässig? Ein Gedicht, das gereimt war, nicht einmal auf subversive Art, vielmehr mit ganz einfachen, meist männlichen Endreimen, also „haar“ auf „gefahr“ und „war“, „aufgestellt“ auf „welt“ und „hält“ – konnte das gutgehen? Offenbar ja. Und wie immer, wenn ein Gedicht aufs Ganze geht (was ein Gedicht ja stets tun sollte), entscheidet die gekonnte Positionierung der Gewichte und Gegengewichte darüber, ob der Balanceakt zwischen Pathos und Ironie, zwischen hohem Ton und Understatement gelingt. Im Fall des falknerschen Liebesgedichts scheint es mir ein einziges, überaus sorgsam abgewogenes Wort zu sein, das dafür sorgt, dass das Gedicht trotz der üppigen Instrumentierung, trotz seines gepflegten Reimschemas, nicht kippt, nicht stürzt, sondern im Gegenteil das poetische Kunststück des Schwebens vollbringt. Es handelt sich um das auf den ersten Blick so gänzlich unlyrische Wort „Pessar“:
ich hab ein flüstern in dein ohr gebettet
es spricht zu dir, daß ich der abend war
die trunkenheit, das zittern im pessar
Eine Wortwahl, die so zwingend wie kühn ist. Stellte man sich ein Gedicht als Gewölbe vor, so wäre das Wörtchen „pessar“ der architektonische Schlussstein, der all die Rippen und Steine davor bewahrt, als Trümmer herabzufallen. Es trägt das ganze Gewicht.
Es war Jahre, bevor ich Gerhard Falkner persönlich kennenlernte, im Café November in der Sredzkistraße – oder war es in einer Privatwohnung gleich in der Nähe im Prenzlauer Berg, in der Dunckerstraße? –, Jahre, bevor Gerhard eine Handvoll von uns jüngeren Berliner Dichtern auf dem Erlangener Poetenfest als die „neuen Leute“ vor- und damit gleichzeitig seine Entdeckerlust unter Beweis stellte, um uns gleich im Anschluss an die Lesung zum Feiern in seine fränkische Gartenschlucht einzuladen. Vorerst hingen seine Gedichte an unserer Wand und gaben, bei kleineren und größeren Runden, früh morgens nach dem Fest oder am Abend während des Essens, Anlass zu Diskussionen – und schienen ein ums andere Mal belegen zu wollen, was Gerhard Falkner in seiner poetologischen Sammlung Über den Unwert des Gedichts, in der immer wieder Sätze von der Prägnanz der stevensschen „Adagia“ auftauchen, postuliert: „Poesie wirkt schlagartig“. Wenigstens sehe ich noch heute, wie eine Freundin spät nachts eben dieses Gedicht vorzulesen begann, zwei Zeilen, drei Zeilen – und dann aufhörte, auf einmal aussah, als sei sie soeben aufgewacht, und noch einmal von Neuem begann, mit plötzlich veränderter Stimme, ganz bei sich und bei dem Gedicht angekommen:
du schläfst und liegst bei deinem haar
dein weißes bein ist aufgestellt…
Jan Wagner, aus Text+Kritik. Heft 198. Gerhard Falkner, edition text + kritik, April 2013
Katachresen
– Beobachtungen an Gedichten von Gerhard Falkner. –
Vermutlich bin ich die jüngste Falkner-Leserin in diesem Band. Davon darf man sich mit Fug einen frischen und, sage ich Ihnen, unvoreingenommenen Blick auf die Gedichte von Gerhard Falkner versprechen. Im Folgenden habe ich einige ,Patentmethoden‘ des Autors, die mich interessieren, zu benennen und anschaulich zu machen versucht. Diese – die Zotenpointe, das Husarenstück und die fickende Uhr – erscheinen eingebettet in ein Weltmodell, das mich diese Gedichte erahnen lassen. Es weicht mit Sicherheit erheblich von dem Weltmodell im Inneren von Falkner ab, den ich persönlich nicht gut kenne. Doch wen würde es nicht ein wenig beruhigen, auf einem Blatt Papier eine Orientierungskarte des Eindrucks skizziert zu bekommen, den er auf sein Gegenüber macht? Sofern keine sehr groben Fehler darin sind, stellt es immerhin eine Art Grundriss der Begegnung zweier denkbarer Weltbilder dar, die bei Lektüre von Gedichten eigentlich das Ereignis ausmacht.
1 Großzügigkeit vs. Schläue
Wie dicht in Falkners Zeilen der geschickte und der täppische Fuß aufeinander folgen!
Wohin trippeln die Silben denn so eifrig?, frage ich mich, wenn ich mehrere Gedichte nacheinander lese oder schreibe. Oft charakterisieren die Beweggründe die Dichter ja viel besser als die Stile. In diesem Fall scheint es darum zu gehen, eine Masse an dauerhaften Monumenten aus dem Material der Gegenwart zu formen. Das als altruistischer, der Menschheit dienender Beweggrund; fürs Private besteht der Nutzen in der ,Vergeilung‘ aller Erlebnisse durch ihre Immersion in antikisierende Gesten. Als Ideal ist angestrebt – und es ist schwierig, so viel zu wollen –, wie das Maul des Laokoon sowohl den Schrei als auch die Würde zu besitzen. Die Ziele sind also auf die menschlichste Weise größenwahnsinnig und machen einem den Dichter gleich auf Anhieb sympathisch.
Was mich für Falkner auch gleich einnahm, ist sein poetischer Mut. Krasse Kalauer neben Hölderlintöne zu verbricolieren verrät eine erfrischende Autodidaxe in Geschmacksfragen – oder bloß karachoierende Autodoxie? Der Stil ist heroisch, unsicher und blind. Das lyrische Ich verhält sich sehr eigensinnig, um sich vor voreiligen Verbündeten zu schützen. Verbündete können einen beirren, beschämen, aufklären oder verführen: die Auflösung des Knotens, als den man seine Identität fühlt, befördern durch Erkenntnisse zur Unzeit, Amputation wesentlicher Schlaufen, gordische Kürzungen durch sein Inneres hindurch, die die Eitelkeit verletzen. Etwa indem sie Common-Sense-Lösungen vorschlagen, die Opfer verlangen, welche die meisten Leute standardmäßig bringen. Das lyrische Ich ist großzügig eher an Stellen, wo keine dauerhafte Verbindung mit ihm entstehen kann. Gerät es in Gefahr, fährt es sich selbst gegen die Wand, bevor ihm jemand etwas kann. So gesehen braucht es seine Leser als Zuseher.
Darin steckt, meine ich, ein gewisses Problem. Falkner neigt, wie viele perzeptive Menschen, dazu, alles zu jeder Zeit selber kapieren zu wollen. Hier wird das Ideal der Bewusstheit, das uns seit der Aufklärung vorschwebt, gefährlich. Denn es ist einfach megaloman. Es bedeutet zum Beispiel, der Loser und der Gewinner zugleich sein zu wollen, zumindest mit deren Perspektive vertraut zu sein; oder sowohl der Sensibelste als auch der Mutigste und Kräftigste sein zu wollen. Es hat zum Kubismus geführt, der als Fortschritt gewertet wurde, während es doch gleichzeitig ein Symptom von Gier ist: „to have your cake and eat it too“. Bei Romanciers führt diese allseitseinsichtige Perspektivensammlerei oft zu einem irgendwie aufgeblasen wirkenden Stil wie bei Karl May oder den elegischen Wimmelbildern von Pynchon, während ein Erzähler, der sich selbst mit seinen Schwächen kennt, erst überhaupt irgendwo hingeraten kann, weil er noch nicht schon überall ist. In der Lyrik sind diese Dinge schwerer zu erkennen, das sprachliche Material steht greller im Vordergrund, aber es ist nicht schwer, die Konstellationen, die hinter Wort- und Soundwahl stecken, zu erschließen.
2 Katachrese
Falkner will sowohl in der Dichtung als auch in der realen Welt bestehen und folgt daher einmal der Logik dieser Welt, einmal der Sprachlogik. Die zwei Logiken korrigieren, prüfen, wecken, provozieren einander. Die Handschrift der Gedichte wechselt häufig die Richtung. Das mag gierig oder unentschieden erscheinen, hat aber wieder auch einen heroischen Aspekt. Falkner möchte die Trennung von Dichtung und Wirklichkeit nicht hinnehmen und macht mit seiner Person sozusagen einen muskulösen Geistesspagat, um mit Verszeilen, Metaphern und grammatischen Mitteln die auseinanderstrebenden Orientierungswelten zusammenzuklammern. Daher sind seine Gedichte stark – und manchmal ungewollt komisch, klumpenweise drastisch. Es brachte mich zunächst auf den Satz „Falkner schreibt die besten schlechten Gedichte“ – aber in dieser Kategorie ist er nicht einzigartig.
Was zum Teufel ist die Katachrese? Sie scheint mir ein Ort zu sein, an dem die Poesie kurz offen klafft und Einblick in ihre Eingeweide gewährt. Dabei muss man schockiert der Poesie intrinsische Disharmonie feststellen.
Um bald zu charaktervolleren Unterteilungen zu kommen, fangen wir an mit dem, was jeder sofort erkennt: gelungene und missratene Katachrese. Bei der Suche nach Argumenten in dieser Diskussion müssten die verschiedenen Arten von Katachresen sich von selbst deutlich hervortun, unbeschädigt durch die schwere Hand eines Vorsatzes. Dies ist natürlich keine Monografie „Die Katachresen Mitteleuropas“, ich erwähne jetzt nur ein paar besondere Delikatessen.
PRELL-ODE
wie lang hab ich jetzt schon
mit meinen augen bei dir ausgeruht
das geschnupfte licht
(um seine zerrüttete farbe zu nennen)
streift wie ein mundgeblasenes saxophon
an deinen hals
du nimmst deinen campari
als wäre er von der hibiskusblüte
und gebraut für die gattenvergiftung
von küste zu küste
mißt du zwölftausend atemstöße
deren nerveninsasse ich bin
(X-te Person Einzahl, S. 71; ursprünglich erschienen 1984 in Der Atem unter Erde)
Es geht mir hierbei vor allem um das „mundgeblasene saxophon“. Wahnsinn, würde ich pfeifen, wenn es das Collier einer mitfünfzigjährigen Literaturvermittlerin wäre. Schweres Parfum. Nach so einer Metapher dreht man sich nochmal um. Über das „geschnupfte licht“ brauchen wir nicht zu sprechen, das hat der Dichter schon selbst kommentiert. Mundgeblasen scheint, für mich jedenfalls, das Zentrum des Gedichts. Was aber hat „mundgeblasen“ für eine Funktion? Meiner Meinung nach dient es dazu, den Fokus metonymisch auf den immateriellen Teil des Saxofons zu schieben, den Ton. Wäre es nicht „mundgeblasen“, würde das Saxofon wörtlich an den Hals der Angesprochenen streifen. Aber kein blaues Minisaxofon aus Glas an einer Halskette kam mir in den Sinn, und schon gar kein physisches Musikinstrument: In „mundgeblasen“ meinte ich zunächst eine Aussage über die Metapher selbst zu hören. Es gemahnt an die konkrete Vorstellung des Glasblasens. Und die Metapher trägt, wie eben mundgeblasenes Glas, die Spuren ihrer unperfekten Schöpfung: Routine, Geschick, Materialnotwendigkeit plus Was-er-sich-dabei-gedacht-hat. In dieser tautologischen Extravaganz steckt eine Bitte um Anerkennung und Verständnis dieser Handarbeit. Ist es denn zu wenig streng, ihr nachzugeben?
Dass Falkner diesen verletzlichen Ausdruck bringt und nicht ängstlich streicht: Ist es großzügig oder Hybris?
Lesen wir gewagte Dichter und sie sind tot, gewinnen wir in vielen Fällen die Vorstellung eines Zirkels, in dem ihre Worte hallen und zu dem zu gehören wir Sehnsucht empfinden. Mal sind es Freundeskreise, in denen Vertrauen erlaubte, so feine Strukturen zu bauen, ohne Angst, ein Grobian machte mit seinem starrsinnigen Unverständnis alles nieder, mal individuelle Kreise des Genies oder Wahnsinns, die wir bewundern und nicht nachahmen. Dabei kann man so leicht übersehen, dass das Gedicht, schon indem man es liest, aus seinen Kreisen tritt und mit einem selbst, dem Leser, kommuniziert. Wenn man das nur zulässt, indem man sich so ein Spiel zutraut beziehungsweise darauf gerade Lust hat. Großzügigkeit verlangt Großzügigkeit.
Die Katachrese also bietet große und schöne Abenteuer an, erweitert die Phantasie, ohne den Geschmack zu betäuben wie etwa eine Suada. Sie darf natürlich nicht bloß als generelle Senkung der Sittenstrenge beim Dichten aufgefasst werden. Der ihr notwendige weite Möglichkeitsraum verlangt im Gegenteil noch mehr Aufmerksamkeit und Zucht als ein durch engere Regeln eingeschränkter. Geschmack nimmt hier die Stelle der Regeln ein. Wo man sich nicht auf Regeln verlassen kann, gibt man sich Blößen, macht man sich leichter lächerlich, zeigt man sich als Mensch, Spott oder Gnade ausgeliefert. Der Dichter hat es gewagt, nun wäre es feige vom Leser, sich hinter einem auf Regeln und Kriterien basierenden rationalen Urteil zu verschanzen.
Im folgenden Gedicht erweckte zunächst das Wort „atemschocks“ meine Skepsis; also es war ein Vertrauensbruch zu bemerken, nachdem ich mich bis dahin, wie meist bei guten Gedichten (Gedichten, natürlich, denen ich als Arbeitshypothese zutraue, gut sein zu können, wenn ich mich auf sie einlasse), ganz dem Text anvertraut hatte. Beim zweiten Blick wurden mir die letzten zwei, drei, vier Zeilen des ersten Teils verdächtig. Dabei ist es eigentlich geblieben: „atemschocks“ scheint mir Blendwerk. Denn wie kannst du dich mit etwas schockieren, das du kontrollierst und reinigst, mit einem Gerät? Leichtgläubiger Umgang mit der Sexualität, Orgontherapie! Dann wiederum: ist es „herzstrahl“, das zuerst mein Misstrauen erregt hat? Das Technische an der Konstruktion und das behauptete Erlebnis, das aber das Wichtige zu sein scheint, krieg ich nicht zusammen. Oder, schlichter, mir ekelt vor diesem Kabinett für kontrollierte Kontrollverluste, und ich tue es als Scharlatanerie ab.
FLEISCH OHNE LICHT
ein herzstrahl
schießt in die kehle
du kennst diese sippschaften
sich feiernder wörter
mit denen man reinigt
womit man sich atemschocks gab
die hinterwelten im thalamus
die strahlend-schönen
wie eine klare nacht
gezuckert von sternen
ragen sie herein in mein
erdbodenfleisch
ins fleisch ohne licht
(X-te Person Einzahl, S. 67, aus der Abteilung „Fleisch ohne Licht“, enthaltend Gedichte aus dem Band Atem unter Erde, 1984)
Zusammengesetzte Neologismen im Deutschen wirken oft wie leere Rüstungen, die der Dichter vor sein Schloss platziert hat, um Zeit zu gewinnen. Bis der Leser wagt, unter das Visier zu schauen, ist die Ehrfurcht dennoch, begründet oder nicht, zu einem Teil des Rhythmus der Sache geworden. Oder ist das Wort diffundiert im Fleisch des Lesers, der nach einiger Zeit versteht, was ihm auf den ersten Blick wie Blendwerk vorkam? Gewöhnt an die grellen Brüche, legt er die Entrüstung ab und bewegt sich mit, als wäre es keine Anstrengung. Bleibt nur die launische Meinung über die Beschäftigung mit Lyrik überhaupt: Stehe ich jetzt wirklich da und bewundere die hohle, kunstreiche, ziemlich seltsame Rüstung eines fremden Mannes, der lange vor mir gelebt hat?
3 Das Husarenstück
Das Husarenstück ist ein gewagtes poetisches Manöver, das am Boden kratzt. Es ist zu erkennen, dass ein Manöver gemacht wurde; meist ist nicht mit Sicherheit zu erkennen, ob das Manöver so geplant oder misslungen ist, da der Husar in sicherem Abstand zum Publikum agiert. Als Husarenstück ist auch zu bezeichnen, was Kinder einander, einen Ring mit Zeigefinger und Daumen bildend, fragen: „Kannst du das?“ – es gibt also auch „falsche Husarenstücke“, Betrug, sowie guten Betrug.
Das mundgeblasene Saxofon war ein Husarenstück, ein weiteres wäre die „herzzeitlose“:
SELBSTBESICHTIGUNG
es hieß, ich wäre ein nein am zerspringen
ein nein, mit dem man in den ställen
den rössern den huf sprengt
ein nein, mit dem man in der hauptstadt
des körpers das hirn aus dem turm bläst
ein nein, mit dem man sich trägt
wenn man ans licht will
nicht das nein vom herrensagen
das barsch hervortritt wie eine staude
eine herzzeitlose
auch kein im stich gelassenes
vielleicht doch nicht
nein, ein nein, das ungefähr eins zu eins
ungefähr du gegen mich
neben mir auftrat
ein nein, in dem es von mir hieß
ich habe gehudelt
(X-te Person Einzahl, S. 66; aus der Abteilung „Fleisch ohne Licht“, enthaltend Gedichte aus dem Band Atem unter Erde, 1984)
Bei diesem Husarenstück sehen Sie die Besonderheit, dass der Husar nach absolviertem Manöver, wenn er vor die Tribüne reitet, um den Applaus zu ernten, aus dem Steigbügel rutscht. Denn „herzzeitlose“, das geht ja gar nicht! Und doch sehe ich Falkners herausfordernden Blick geradezu vor mir, lauernd, und er wird nicht weggehen, bis ich sage, doch, es geht vielleicht in dem Fall doch. Ich weiß es nicht. Weil das Gedicht weitergeht, und diese Zeile somit Verantwortung hat und nicht wie eine Pointenzeile alles für einen Witz verschleudern kann, meine ich eigentlich, es geht definitiv nicht.
Also das Husarenstück muss gefährlich sein, und es muss spektakulär sein. Mitreißend, mit dieser Mischung aus Schönheit, praktischer Erfahrung und Witz, Eitelkeit, Anarchismus und Ernst, die die Berittenen so anziehend machte. Das Husarenstück ist flüchtig und stirbt mit seinen Künstlern. Es ist windig, psychologieabhängig, unverlässlich. Es erfordert ganze Hingabe, die nur manchmal mit Glück belohnt wird. Es zeigt keine Fähigkeit, sondern einen Menschen: ein Können, das ins Blut übergegangen ist und nur mit einem ganzen Lebensstil erreicht werden kann – don’t try it at home. Es ist etwas, worauf sich ein Dichter zu Recht etwas einbilden kann; er hat es sich antrainiert und es beeindruckt. Bloß ist es für die Qualität des Manövers essenziell, den Wert der Fähigkeit immer entweder zu überschätzen oder völlig niederzumachen. Es ist die Art von Manöver, die viel aushält, nur nicht den Schätzmeister. Es ist fleischgewordenes Showbiz – vielleicht ohne Biz.
4 Die Zotenpointe
Falkner macht oft fette Pointen, die sich auf den zweiten Blick als hallende Zoten entpuppen. (Ich nenne Zote eine jähe Anspielung auf sexuelle Handlungen.) Sie bringen einen in Verlegenheit, finde ich. Was soll man damit anfangen? Verlegenheit – analysieren! Was ist, abstrakt gesehen, ihre Wirkung? Ein Kleines (die Zote) hallt groß und das ist peinlich. Oder etwas Großes verliert (Zote) die Hose (Slapstick). Das passiert, wenn in einem Gedicht die Schlusspointe möglicherweise bloß eine Zote ist. Wegen Falkners hohem Ton kommt das tatsächlich so unerwartet, dass man, wenn die Zote nicht ganz eindeutig feststeht, daran zweifelt, ob man die sexuelle Lesart nicht selbst erst hineingelesen hat. Zoten im Gedicht, das pompöse Rezitieren eines Gedichts in einem Gespräch, eine plötzliche Möse im D-Zug und ähnliche unerwartete Sprechakte fordern oder bieten eine neue Sprechart, stellen den Hörer oder Leser vor die Entscheidung, diese Ebene zu akzeptieren, was von ihm eine schnelle Mit-Bewegung verlangt, oder sie abzulehnen, was erlaubt, die Trägheit zu wahren, die bei uns so oft mit Würde verwechselt wird. Die Zote macht die Situation des Gedichts also mit einem Schlag… interaktiver.
Die Zote hat jedoch den Nachteil, dass Sex einen so dominanten Effekt auf den menschlichen Organismus hat, dass es schwer ist, die Auswirkungen solcher Anspielungen bei verschiedenen Individuen in der Hand zu behalten. Es bleibt nur das eigene Maß, und damit geht leider eine gewisse Suggestion einher, die sich mit der Provokation zusammentut: Seid wie ich, Leser, und mögt mich, oder all mein Prunk und Spaß ist nichts für euch. Wie trist das in sich zusammenfallen kann, lässt sich sehr gut an folgendem Beispiel sehen:
DIE ENTHÜLLUNG DES PFIRSICHS
schau mal her, ich bin soweit
leuchte in zerrissenheit
mein leib ist eins
mein sinn sind zwei
als trennendes wirkst du dabei
nicht groß genug, um zu verknüpfen
nicht klein genug, um zu entschlüpfen
bist du der riß, der durch mich geht
als auch das licht, in dem er steht
(X-te Person Einzahl, S. 115 – aus dem Band wemut, 1989)
Ein rätselhaftes Ding. Ich werde jetzt sogar rot. Warum? Wahrscheinlich wegen des Themas, vielleicht wegen des unklar wechselnden Inhalts des Wortes Du (angesprochen ist halb das Gegenüber, halb der Schwanz des lyrischen Ichs, wenn ich das richtig verstehe), doch sicher wegen des Zielens der Darstellung auf Mittelmaß. Das ist für ein Gedicht recht ungewöhnlich und es gefällt mir nicht. Ich mochte noch nie die Phrase „er steht“, genauso wenig die Vorstellung vom Geschlechtsakt als Arbeit oder Kompromiss, und die Darstellung von irgendetwas als weder klein genug noch groß genug ist mir zum Aus-der-Haut-Fahren. Während der ganzen Szene herrscht ein unangenehmer Exhibitionismus von Halbem. Das lyrische Ich ,kriegt keinen hoch‘, und kann keinen Augenblick sich selbst vergessen. Das erbarmungslose Licht ist eine vorgebliche Sachlichkeit, alles wird eingefangen in der selbstverschuldeten Einfallslosigkeit dualistischer Spekulation. Der Wunsch zu zeigen wird als Teil der Gedichtwirklichkeit ausgesprochen, meint den Schwanz. Der Wunsch, sich zu zeigen als Hintergrund der Gedichtveröffentlichung, wird ganz verdeckt und ist doch geheimes Movens aller Gedichte, seine Heimlichkeit ist wichtig für deren Leuchten. Die Appropriation des Zeigewunsches durch den Inhalt ist aber eigentlich ein ganz interessanter Effekt. Mein Widerwille schwillt erst mit der letzten Zeile vollständig an – unangenehm umrankt allerdings vom leicht läppischen, schlappschwänzigen Ton der Reime „verknüpfen“ / „entschlüpfen“. Hier soll wohl wie immer Wirklichkeit gezeigt werden. Aber es geschieht so funktionalistisch, und der Triumph ist ein solches Gerade-noch-Genügen, dass die Wirklichkeit, gewohnt, von einem Gedicht gerühmt oder wenigstens gepeitscht zu werden, sich entleert abwendet. Die Hybris, solch fade Normen über alles zu stülpen, ist der Tod! Kann man vielleicht sagen: Die uneuphorische, dennoch durch pflichtschuldige Plackerei penetrierende Schamlosigkeit dieses Gedichts erzeugt Scham?
Das Peinliche an Sexszenen ist aber doch nie deren Situiertheit in fremden Soziotopen und nie ihre Trieb- und Zwanghaftigkeit – das macht ja alles ihre Anziehung aus. Peinlich von vornherein eingeschränkt wendet die Lust sich ab, wenn ein Normalitätsanspruch sich so allgemeingültig breitmacht. Sie werden in diesem Punkt hoffentlich andere Gefühle haben als ich.
Häufig den Geschlechtsverkehr als Bildspender zu verwenden, und das noch nonchalant, erweckt den Eindruck, man habe es entweder mit einem lechzenden Phantasten oder mit einem Prahler zu tun. Oder, natürlich, mit einem beredt sich reflektierenden Don Juan. Da das Wesen des Don Juan darin besteht, zu gut zu sein, um wahr zu sein, stehen wir vor dem Problem, nach dem Haken zu suchen. Das ist ungut. Aber vielleicht alles eine falsche Fährte.
Weist die letzte Zeile möglicherweise auf Sex hin, bietet das eine Art von Transsubstantiation an – ein Leichtes und ein Passendes eigentlich, denn der Stoff, aus dem Sinn und Pointen bestehen, kennt nichts Verwandteres als den Stoff der Liebe. Das Gedicht verwandelt sich in ein Prisma, ein Fenster, ein Gesicht, eine Situation, die man moralisch, ästhetisch liest – so natürlich, wie man bei der sexuellen Transsubstantiation in graue Visionen übertritt. So wandelt sich durch eine Zotenpointe die Frage, ob das ein guter Dichter schrieb, ein bisschen in die, ob das ein guter Liebhaber war. Es appelliert an unseren Geschmack als Menschen, nicht an unsere Kriterien als Kritiker. Es buhlt nicht nur um unsere intellektuelle und ästhetische Anerkennung, sondern um die Sympathie unseres Geschmacks, bei dessen Prozessen sich die Sexualität als letzter, unbequemer Zeuge immer wieder bewährt. Wendet der Text also den Blick ab von der anderen Person im Gedicht und besingt nur das eigene Funktionieren, hält man gleich weniger von ihm, wird sogar ernstlich böse auf das lyrische Ich, wie auf einen Freund am Schlüsselloch, der die Kamera auf die uninteressantesten Gegenstände draufhält. Ein Dichter-Liebhaber, dem der Reim aufs Eigene mehr bedeutet als die Geliebte, ist kein sonderlich bewundernswertes Ding. Das ist heikel – denn es gibt tausend Gründe, etwa der Diskretion und des Respekts vor ja doch unbekannter Psyche, um um den Geliebten herum einen blinden Fleck im Gedicht zu lassen. Will man sich von so etwas nicht die Hochachtung verderben lassen, findet man sich wieder, wie man sich an das schon fast verhasste Gedicht schmiegt, ganz wie ein verzweifelter Partner, der verzeihen will, um das Beste am anderen nicht zu verwerfen. Nun, das ist die Lesehaltung, die die Konkrete Poesie von uns forderte, in einer etwas lutheranischen Version: den aktiv an sich, der Sprache und seinen Urteilen forschenden Leser.
Nachdem wir die Situation von vorhin durchgestanden haben, bewundern Sie nun etwas außerordentlich Feines, ein Husarenstück in Zote:
NAKED LUNCH POEM II
du wirfst die letzte frage auf
ich kann sie lecken und fassen
der stuhl steht auf vier beinen
staunend unter dir
wie wohlgegründetes gesetz
unter menschlicher schwäche.
er irrt
(X-te Person Einzahl)
Trotz des leicht forcierten Anthropomorphismus des staunenden Stuhls ist dies ein tolles Stück. Der Punkt am Ende der vorletzten Zeile ist ungewöhnlich, meist setzt Falkner keine Satzzeichen. Hier ist der Punkt noch notwendiger als eine Filzscheibe unterm Stuhlbein. Im leeren Raum unter dem Gedicht sieht man nämlich dann den Stuhl (staunen tut er natürlich nicht) getrieben von den Aktionen der unsichtbaren Protagonisten im Zimmer herumirren. In der zweiten Bedeutung des letzten Worts wird der Stuhl – durch physische Bewegung – vom Irrtum seiner metaphorischen Identität, des „wohlgegründeten Gesetzes“ überzeugt. Das ist sehr kunstfertig und gehört ins Prager Kuriositätenkabinett zu den fickenden Uhren etc., nein wirklich.
So exquisit obszön, peinlich oder riskant sie immer sind, Falkners Manöver sind doch meist eins: wirklich. Daran merkt man auch so deutlich, wenn er nachlässt: Es wird dann mythologisch.
5 Die Wahrheit und die Möbel
Klassische Gedichtmöbel flankieren also pervers-intime Katachresen. Als Muster in Falkners Gedichten – sie gehören zu jenen natürlichen Mustern, die sich aus der Materialbeschaffenheit der Substanz, in diesem Fall von Falkners Seele, ergeben oder ihr gemäß gewählt werden, kurz, sie gehören zum Ernst – findet man das Pathos, den Hölderlin-Ton, das Ausleben des Einsseins mit der Sprache bis zu jenen sprachlichen Orchideen – und dann den Bruch, das Abwenden, das leichte, harte Wort, das herzblutende Werfen mit banalen Gegenständen, gelegentlich Resignation. Die Bereitschaft, für eine Maverick-Geste alles wegzuwerfen, wäre genug, um ein Gesamtwerk moralisch zu verurteilen. Doch Moral und Konstanz werden überstrahlt von Falkners Gabe, der körperlichen Vertrautheit mit der Sprache. Gelegentlich verschenkt er hier eben seine Prinzipien in einer Geste der Hingabe an irgendetwas Sentimentales oder Banales wegen des Pathos dieser Geste oder dieses Pathos in aller Unschuld unwillkürlich erzeugend. Meistens wächst Falkners Sprache, wie ein Baum wächst, mit einer gesetzartigen Richtigkeit noch in allen Seltsamkeiten.
Wenn er schreibt:
DIES KLAGENDE, SCHWARZE HÖHNEN
wie esau
starrend von schweinemist
im schmutz meiner worte
trat ich vor deine schwelle
einen bären
über den schultern
und flehte:
erleg meinen engel
aber du
im abschaum der jahre
wehrst mit der flachen hand
und jagst mich
ins rätsel zurück
(X-te Person Einzahl, S. 104, aus wemut)
so fragt sich eigentlich nur, warum der Bär?
Es sei ja jedem Dichter unbenommen, das Rätsel für sein Rätsel zu halten. Vielleicht käme nur verlogene political correctness heraus, wenn einer sich zu anderen Vorstellungen zwingen wollte. Und doch ist die Konstruktion gemein und eitel. Alleine im Rätsel sauen und dann von Außenstehenden filmreif abgelehnt werden, ja das hättest du gern. Den Engel als Joch, den Anderen als mitleidlose Silhouette in der Tür. Der Poet schiebt das Unpoetische ab auf die anderen, denen man Schuld und diese fürchterlich owizahrerische Weisheit zuschreiben kann, die jugendliche Einbildungen mit optimistischen Sitzkissen erstickt, lebensfreundlich ist und resignativ nur den kleistischen Jugendlichen erscheint. Wer prolongiert und forciert kleistisch ist, wird unehrlich, indem er sich weigert, die seelische Radikalität anderer hinzunehmen. Der Poet missbraucht die anderen in seinem Gedicht sehr oft als Mama. Muss es so sein? Es muss wohl. Es ist vielleicht wirklich ein notwendiger Nebeneffekt, der sich einstellt, wenn man sich von der Sprache statt von der Gesellschaft seine Lehren holt. Bei einem Haufen undurchsichtiger Wendungen und großem Talent kriegst du als Leser das Gefühl, er weiß vielleicht selber nichts anderes, als dir und sich selbst, wie er es gewohnt ist, in jugendlicher Torheit einen Bären aufzubinden. Wie jeder Gaukler Weisheit und gutaussehenden Blödsinn zu einer betörenden Existenzialismusshow vermischt. Und dann blätterst du um und da ist sie tatsächlich, die Kacke des Bären.
alle wollen mit der sprache, meiner mutter,
um die fahne raufen
ich soll der heimat aus dem wortschatz
land verkaufen
(X-te Person Einzahl)
Das Komische ist: Es stimmt und stimmt nicht. Er schreibt aus dem untrüglichen Gefühl, die Sprache zu sein, und dabei, also bei der Wahrheit, kommen so ungelenke Bilder heraus wie dieses von der Mutter, die die Sprache ist, und einer Schar Mitschüler, die mit ihr um eine Spielfahne raufen, aber eigentlich nur ihre Brüste erhaschen wollen, was – glaube ich – an dem vorbeigeht, was mit dem Satz gemeint ist, der nämlich eher im Geist des Kopfstoßes von Zinedine Zidane steht. Was ich auf den ersten Blick, wiewohl betrunken, auch ganz richtig verstanden habe. Falkner ist gefeit gegen das Falsche, aber die, die zusehen, sehen es dennoch. Und eigentlich will er das auch. Er will Wahrheit, auch mit dem Mittel der Peinlichkeit. Er will, dass alle zugeben, dass auch sie von Geburt an besitzen und mit dem umgehen, was sie lieber vom Dichter in ungefährlichen Filetstücken kaufen. Um nach westeuropäischer Art über der Wahrheit zu stehen; um geschickter zu sein als die Wahrheit; um sich als kleine Halbgötter zu fühlen, wie man es durch den Besitz gewohnt ist. Und deswegen baut Falkner in die noblen Grundstücke, die er ,verkauft‘, immer ein bisschen peinliche Momente ein. In denen man merkt: Er ist da.
Ann Cotten, aus Text+Kritik. Heft 198. Gerhard Falkner, edition text + kritik, April 2013
Gerhard Falkners Antwort auf Ann Cottens Beitrag: Katachresen.
Ann Cottens Brief auf Gerhard Falkners Beitrag: Ann Cottens Schwuppdiwuppismus
Gerhard Falkner – Ein Dichter im Gespräch mit Ludwig Graf Westarp. Über Berlin und die Bedeutung kunstspartenübergreifenden Arbeitens.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Seelenruhe mit Störfrequenzen
Der Tagesspiegel, 14.3.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Laudatio + KLG + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Gerhard Falkner liest auf dem XI. International Poetry Festival von Medellín 2001.


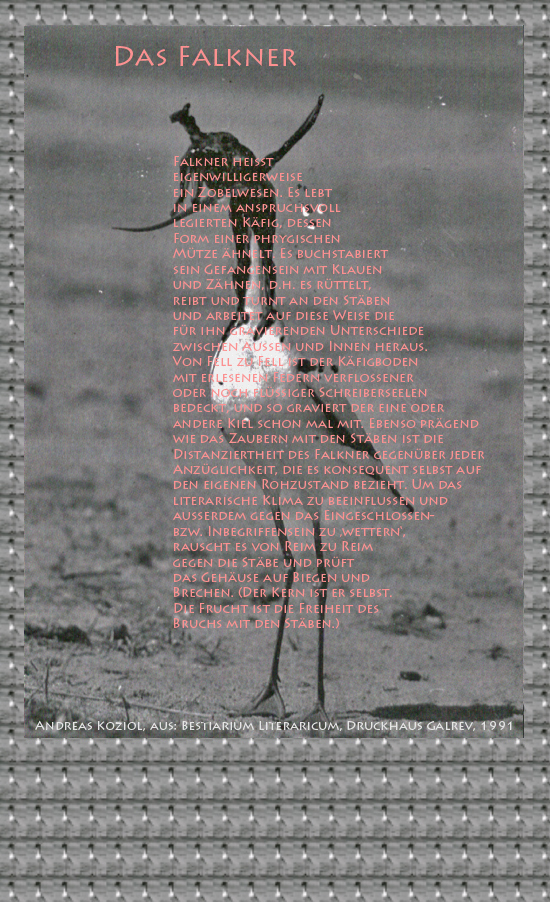












Schreibe einen Kommentar