Kathrin Schmidt: Blinde Bienen
BRONCHIALE STUNTS
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafür Thomas Kling
dass du nicht länger bleibst, scheint abgemacht. die
aaaaaharzigen
gerinnsel, die vom leibe gehn, sind gift und gallig. das
aaaaabittre
stört nicht. trägst du leinen?, stört die frage, schon,
den gang der dinge, lauf der sterne, und im
aaaaahandumdrehen,
feucht und zitternd, liegst du da: zum end, beatmet.
in deine bronchien, wo inzwischen kaskadeure nisten
und zwischen stunts ein stelldichein riskieren, strömt
kaltluft ein und frostet kapillaren, das blut steht still
und steif und rührt sich nicht, und wo dein herz war,
hängt ein muskelsack, und deine augen wolln mit mir nicht sprechen.
ein perlmuttfarbnes haustier ist der tod, sein schildpatt
tarnt ihn. die narkotika am wege, tabak und petunien,
blühn noch nicht, und was mein halfter war, in dem
ich mich bewegte, zählt nicht mehr.
Motivreichtum, Sprachspiele, Klangvielfalt
und frappante Brüche – hier wird alles geboten, was das Gedicht an Möglichkeiten gewährt. Unangestrengt genau, beiläufig bedeutsam, direkt auf den Leser, sein Herz und seinen Verstand gezielt.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Klappentext, 2010
Diese Poesie will es auf den Punkt genau
Im vergangenen Jahr veröffentlichte die 1958 in Gotha geborene Autorin Kathrin Schmidt ihren vierten Roman. Du stirbst nicht erzählt von einer blitzartig lebensbedrohenden Krankheit und dem allmählichen Gesunden nach einer riskanten Operation. Indem sie Sprechen, Lesen und Schreiben ganz neu lernen muss, erobert sich die Hauptfigur, eine Schriftstellerin, die Welt zurück. Du stirbst nicht ist das bisher bedeutendste Werk der Kathrin Schmidt – und ein exemplarisches obendrein.
Ihr Schreibleben begonnen hat sie mit Gedichten. Der frühen Lyrik widmete sich 1982 ein Band der renommierten DDR-Reihe Poesiealbum, Mitte der neunziger Jahre erschien bei Suhrkamp die Sammlung Flußbild mit Engel. Danach machte Kathrin Schmidt vor allem als Erzählerin von barocker Sprachkraft auf sich aufmerksam. GO-IN der Belladonnen, der bisher letzte Lyrikband, liegt nun schon ein Jahrzehnt zurück.
Prosa und Poesie verhalten sich in ihrem Fall zueinander wie kommunizierende Röhren: Nach oben hin und also ins Offene hinaus entfaltet sich jedes Genre nach seiner eigenen Fasson, unten aber, am Grund des Schreibens, sind sie eng verbunden. Wodurch? Vorab durch eine schier unbändige Worterfindungslust als dem besten, mithin notwendigen Gegenmittel wider das Stummbleiben etwa im autoritären Staat oder das Stummwerden aus existentieller Not. Nicht erst seit dem jüngsten Roman, sondern von allem Anfang war dieses Antidot ein entscheidender Antrieb in Kathrin Schmidts Sprachwerkstatt. Dass sie in deren lyrischer Abteilung auf konsequenter Kleinschreibung besteht, hat auch damit zu tun. Wenn jedes Wort ein so kostbares wie beschwerliches Finden und Erfinden verlangt, haben alle Wörter untereinander den Anspruch, zumindest zeichenhaft gleichrangig zu sein.
Das übermütigste Gedicht im neuem Poesiebuch Blinde Bienen heißt „effendi im effektenfieber“. Es zeigt uns einen etwas stürmischen Herrn, eben den „effendi“ des Titels, der sich auf Brautschau begibt. Ihrerseits wertbeständig soll die zu Erwählende sein, zugleich aber auch der Wertsteigerung des Werbenden dienen – der Effekt, den sie macht, dient seinen Effekten. Welch ein trefflicher Anlass für die Feministin Kathrin Schmidt, nun als Poetin ihre ganz singuläre Alliterations- und Allusionsenergie so recht in Schwung zu bringen und dann so frei wie gezielt walten zu lassen.
Angespielt wird dieses Mal auf Ernst Jandls absichtsvoll frauensarkastisches Poem „Eulen“: „bist frau? bist eulen?“ hebt der „effendi“ an. Sodann treten vom „hemdchen“ übers „brüstlein“ bis zum „röckchen“ putzmuntere Diminuitive auf, um gleichermaßen für Verlockung wie Verwirrung zu sorgen. Eine Pointe des Gedichts verdankt sich dem Doppelsinn des Wortes „Anzug“: Der Werbende wähnt Zurückweisung „im anzug“, steckt aber auch in einem. Beide Wortbedeutungen fügt Kathrin Schmidt zunächst eng aneinander, um sie dann durch einen ihrer expressiven poetischen Punkte – „punkt. Machen“ heißt ein Programmgedicht des Bandes – gleich wieder messerscharf zu trennen. Aus dem Anzug fällt der „effendi“ deshalb, darf zur Strafe unter den Säulenheiligen Platz nehmen und wird zum gutbösen Beschluss, Berlichingen lässt grüßen, vom „eulenfräulein“ noch „mit einem runden / ja“ allerwertest verabschiedet.
Gut gelaunt und heiter führt „effendi im effektenfieber“ das artistische Arsenal vor, über das die Dichterin auch bei ernsten, gar todtraurigen Versanlässen gebietet, etwa beim lyrischen Nachruf auf den an Lungenkrebs gestorbenen Dichterkollegen Thomas Kling: „bronchiale stunts“ lautet der aus Verzweiflung herbe Titel. Fast alle Gedichte werden von einem lyrischen Ich im Gang gehalten, das sich im Selbstgespräch als mal vertraute, mal sehr fremde, immer jedoch als andere, zweite Person wahrnimmt – „ich häftlingin du“. Unter den erkennbar autobiographisch grundierten Poemen leuchtet ebenfalls ein Nachruf hervor, dieses Mal einer zu Lebzeiten und auf jenen „zerbrochenen bruder“, der bei der Stasi war und doch im „schädelfach“ der Schwester ein ganz Naher, ein Nächster bleibt.
Sieht man von einigen zu üppig, damit wohlfeil gesetzten Genitivmetaphern wie dem „pfahl des verzeihens“ oder der „sprachenbrache des erinnerns“ einmal ab, herrscht in Kathrin Schmidts Blinden Bienen allenthalben die reine Kunstfertigkeit. Sie zu bewundern ist legitim, auf die Dauer, es sei zugegeben, aber auch etwas anstrengend. Diese Dichterin verlangt stets nach dem erkennenden Leser. Ihn ohne intellektuellen Umweg unmittelbar zu rühren käme ihr nie in den Sinn.
Jochen Hieber, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.7.2010
Die Sprache wiedergefunden
− Nach einer Hirnblutung verlor die Schriftstellerin Kathrin Schmidt Erinnerungen und Sprachgefühl. Ob sie jemals wieder Gedichte schreiben kann, war unklar. Nun ist ein neuer Band von ihr mit dem Titel Blinde Bienen erschienen. −
Die Schriftstellerin Kathrin Schmidt kann nach einer Hirnblutung weder auf ihr Erinnerungsvermögen noch auf ihr Sprachgefühl zurückgreifen. Wortbedeutungen haben sich verflüchtigt und ihr Gedächtnisteppich ist von Löchern durchsetzt. Am Beispiel von Helene Wesendahl beschreibt sie in ihrem 2009 mit den Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman Du stirbst nicht, was es heißt, wenn sich das Leben schlagartig ändert und man Sprechen und Schreiben wieder wie ein ABC-Schütze lernen muss.
Als Kathrin Schmidt wieder Prosaarbeiten gelingen, wusste sie weiterhin nicht, ob sie jemals wieder Gedichte würde schreiben können. Nun hat sie mit Blinde Bienen einen neuen Gedichtband vorgelegt, der mit dem Gedicht „ich häflingin du“ eröffnet wird. Im Zentrum des Gedichts steht ein lyrisches Ich, das sich mit Erinnerungsbruchstücken begnügen muss. Ihre Existenz ist nach einem Schlaganfall im Gehirn gespalten, wobei sie mit jemandem „verhaftet“ ist, den sie nicht kennt. Eindrucksvoll handelt dieses Gedicht von der Irritation, in der sich das lyrische Ich nach der Krankheitskatastrophe versucht zu orientieren. Die Rede ist von einer „bruchstück. Haft“. Sie ist eingesperrt. An ihrem Bett steht das „sensenfräulein“, doch das „rechte leichlein“ ergibt sich nicht seinem Schicksal, sondern es dengelt die eigene Bewusstseinssense und findet so allmählich über die Sprache über das „Du“ zum eigenen „Ich“ zurück.
Unweigerlich müssen dabei die Tiefen der eigenen Biografie erkundet werden. Bei diesen Exkursionen erinnert sie sich – wie in dem Gedicht „wer anderen ein ei ins nest färbt“ – an die eng bemessenen Lebenskleider, die aus den „volkseigenen nähten“ platzten und die sie in „kirsch“ oder „braun“ bis zum „abmickeln“ aufgetragen hat. Was einst fest ge- und verstrickt war, wird im Gedicht sprachlich aufgetrennt, sodass immer wieder Konstellationen zu jenem „Du“ hergestellt werden, auf das das lyrische Ich fremd reagiert („landname“).
Neben diesen Gedichten, die reale Bezüge aufweisen, finden sich in dem Band surreale Verse, die der Lust an der wiedergefundenen Sprache geschuldet sind. Diese Gedichte platzen aus anderen Nähten, denn sie werden nicht von dem „Sinn“ zusammengehalten. Kein Verstehenskleid passt Kathrin Schmidt diesen Texturen an, die sie vielmehr in ihrer eigenwilligen, durchaus auch verstörend klingenden sprachlichen Schönheit belässt. Eingeschrieben ist ihnen jene Freude darüber, dass sich die Worte in ihren vielfältigen Kombinations- und Bedeutungsmöglichkeiten wieder zurückgemeldet haben. Man liest und staunt und staunt immer wieder erneut, je öfter man liest, was Kathrin Schmidt da hervorgezaubert hat.
Michael Opitz, Deutschlandradio, 18.3.2010
Die Hypotenuse schlägt Haken
− Mit Blinde Bienen kehrt Kathrin Schmidt zur Gedichtform zurück. −
Über Manches reibt man sich in der Ära galoppierender Oberflächlichkeit die Augen, so auch über die Reaktionen zu diesem Buch. Blinde Bienen ist, will man der abwägenden, vorsichtigen Euphorie der Feuilletons glauben, ein Ereignis. Sofern es einem Gedichtbuch heute noch gelingt, ein Ereignis zu sein: das lässt aufhorchen und nach den Gründen fragen. Sei es das schlechte Gewissen des Groß-Feuilletons, seine in Lyrik-Dingen nicht allzu selten zu Tage tretende Überfordertheit und Ratlosigkeit an einem guten Gegenbeispiel abzuarbeiten – oder sei es gar, dass es tatsächlich einen bestimmten Anteil Lyrikleser in dieser Klientel geben sollte. Man will es zufrieden sein, wenn es denn das richtige Buch, den richtigen Autor zur rechten Zeit trifft.
Die Überwindung des Endgültigen sorgt sogar auf einem vor lauter Abgeklärtheit oft nicht zum Wesentlichen gelangenden Tummelplatz wie dem Literaturbetrieb für Rührung und Erstaunen. Die Rückkehr in die angestammten Jagdgebiete ist zuweilen, durch einen Geröllhang des Schicksals, eine Zeitlang verstellt. Über wenige ernst zu nehmende Schreiber wurde in den letzten zwei Jahren so ausführlich in Bezug auf die Verbindung von Autor und Werk gesprochen wie über Kathrin Schmidt, deren Weg als Lyrikerin begann, aber erst, um ihren 40. Geburtstag herum, mit dem ersten Roman eine entscheidende und überfällige Beschleunigung in Ruhmesangelegenheiten erhielt. Inzwischen hat die Zahl ihrer Romane die der Gedichtbände überflügelt, und doch gibt es eine hartnäckige Anzahl Bewunderer, die Kathrin Schmidts hauptsächliche Qualitäten in der Lyrik sehen.
Du stirbst nicht, der Roman einer Krankheitsgeschichte, die der der Dichterin gleicht, sorgte schließlich mit dem Deutschen Buchpreis für eine schöne Sensation. Blinde Bienen setzt, in anderer Weise, an der Stelle des Buches an, wo es um die Frage geht, ob und wie es um ein Fortschreiben am lyrischen Werk bestellt sein könnte. Gewissermaßen erbringt der Gedichtband den Beweis, dass es auch aus der Situation eines absoluten Neuanfangs, der im Roman die Hauptfigur Helene noch verzweifeln lässt, heraus wieder Gedichte geben wird, und Hoffnung.
Die Kenntnis dieses Umstands fordert zunächst zur Vorsicht auf. Allerdings: Von Rekonvaleszenz ist in diesen Texten keine oder allenfalls eine hintergründige Spur auszumachen. Was so manch Anderer gebetsmühlenartig versprechen mag, hier wird es erstaunlicherweise gehalten: knackig und kühl sind die Codes in Kathrin Schmidts „Blinde-Bienen“-Gedichten. Mit poetischem Gesäusel ist in diesem Buch nicht oder kaum zu rechnen, die Einkehr ins Ur-Metier der gebürtigen Thüringerin erfolgt mit Distanz und Gelächter. Nach dem Paukenschlag in Frankfurt im letzten Herbst mit Du stirbst nicht ist das möglicherweise die richtige Strategie, sicher auch, um die damit einhergehende Vereinnahmung durch die Bedürfnisse und Anzüglichkeiten eines eventversessenen Betriebes zu umgehen, dessen vorgebliches Interesse das Buch vielleicht erst ermöglicht.
Krachledern und unwirsch setzt es einen verbalen Hieb am Anfang: „wasn zuletzt?: vogelkloppe / ums tote insekt“ in „ich häflingin du“, das den Ton, das Verwirrspiel der Blinden Bienen eröffnet. Gottseidank hat Kathrin Schmidts Dichtung nur wenig mit der tragischen Unsinnlichkeit und dem eisigen Wortgebröckel diverser schicksalsloser Neutöner zu tun, die bereits zu Lebzeiten mit ihrer aufkommenden Vergessenheit ringen. Vielmehr scheint es in diesen Texten einen feinen Pfad zu geben, der etwa zwischen dem Formbewusstsein einer Sächsischen Dichterschule, ihrer Nachwehen und dem, wie man sich ein auswegfernes Geschäft wie die Lyrik in der so genannten Jetztzeit vorstellen mag, auf eine reizvolle Weise vermittelt. So ist es nicht verwunderlich, dass es in „wer anderen ein ei ins nest färbt“, das über die Umstände des und die erwachende Exzentrik durch das Schreibersein spricht, ‚braunt‘, ‚erbt‘, ‚endlert‘ und ‚kirscht‘ bis zum ‚abmickeln‘. Oder umgekehrt: die Überwindung eben jener bald zu engen Kleider, als die Schmidt die Arbeit der Vorausgänger beschreibt, zeugt, möglicherweise sogar über den Umweg des Sätzezerkrümelns, eine Hinwendung zur Eigenart, die man getrost wieder als Poesie bezeichnet. Der Abschied von Kling („bronchiale stunts“) fällt ähnlich kristallin aus wie oben genannte Nestfärberei an Braun: „ein perlmuttfarbnes haustier ist der tod, sein schildpatt / tarnt ihn. die narkotika am wege, tabak und petunien, / blühn noch nicht, und was mein halfter war, in dem / ich mich bewegte, zählt nicht mehr.“ Am Ende steht jeder Dichter wieder bei sich, kalibriert seinen Hang zu sich selbst.
Zuweilen mag man in dem Gemenge von Frechheit und Kühlheit, das die Gedichte Kathrin Schmidts ausmacht, eine Art Überdruss, einen Hauch Belanglosigkeit ausmachen, obwohl man weiß, dass diese Annahme angesichts der gerade hier augenfälligen Engführung von Autorin und Sprecherin womöglich nicht gerechtfertigt ist. Der Eindruck mag der nahezu durchgehend lakonischen Grundhaltung der Blinden Bienen geschuldet sein, mit dem das Aushalten eines Fatums an der einen oder anderen Stelle förmlich in die zweite Reihe gestellt wird.
Einzig ärgerlich erscheint bei genauerer Betrachtung der sequenzweise recht lax wirkende Umgang mit Wortdopplungen und -verdrehungen, die nicht selten lediglich in der leicht abtörnenden Kraft eines müden Kalauers enden. „haarriss“ und „hassriss“, „feuerzeugnis“ und „fintentinte“ sind, auch wenn sie im Text „spiegelgedoppelt“ von wiederum oszillierendem „mohnwispern“ und den „tiden des irrens“ verfolgt sind, Beispiele für einen Überschwang, der durchaus mal ins Leere geht und der Kathrin Schmidt im Verfolgen ihrer wiedergefundenen Sprach- und Assoziationskraft nicht dauerhaft vonnöten sein wird. Groß ist hingegen der Beginn eines Gedichts wie „saum und sander, zaum und zander“, der das Mittelmaß im Titel auswetzt:
die luft lehnt reglos am geschiebefächer, fossile
chakren depeschieren, fühlbar. die energien
ziehn dir die schuhe aus, du angelst barfuß, wo am saum
des sanders die hechte weiße wassernähte heften.
Alles in allem ein Buch, das sich an die lyrischen Vorgängerbände, insbesondere Flußbild mit Engel, nahezu bruchlos anschließen lässt und das auch deshalb Freude bereitet, weil es auf den kränklichen, näselnden Ton, wie er in der Lyrik der Gegenwart weitläufige Verbreitung gefunden hat, vollständig verzichtet. Auf Weiteres darf (und soll) man gespannt sein.
André Schinkel, literaturkritik.de, 8.8.2010
Vom Sensenfräulein
− Der Mond, die Zeit, das Herz: Sie tauchen in den Versen von Kathrin Schmidts Blinde Bienen auf. Nicht nur die Trägerin des Deutschen Buchpreises 2009, weiß, dass das nichts gegen die Originalität des Lyrikers sagt. −
In den Zeilen der Dichter trifft man fast unausweichlich auf ein paar übliche Verdächtige: den Mond, die Zeit, das Herz, den Schmerz, die Liebe, die Tiere, das Ich und das Du. Nicht nur Kathrin Schmidt, Trägerin des Deutschen Buchpreises 2009, weiß, dass diese Tatsache nichts gegen die Originalität eines Lyrikers sagt.
Im Gegenteil, gerade die alten Hasen und Häsinnen im Versland suchen den Kontakt zur und die Konkurrenz mit der Tradition, die ja viel mehr bietet als eine unendliche Spielwiese. Schmidt findet dort bei Heine, Jandl, Claudius, wie in der geformten Sprache überhaupt, Trost und – ein zumindest zeitweise wirksames – Antidot gegen den Tod.
Auch deshalb durchziehen durch den Wortspielwolf gedrehte Redensarten ihren neuen Gedichtband Blinde Bienen: Das „heutige haus schlägt drei fensterkreuze“, man erkennt zuweilen „verlorene lippenmüh“ und in „schnabeltasse“ heißt es: „du fasst den tassenschnabel am wunden punkt“.
Mit Tod und Krankheit kokettiert Schmidt an einigen Stellen fast schon, doch nicht aus Gefallsucht. Vielmehr führt die Faszination ihr die Feder, dass so viele Vers-Freiheiten wieder und weiter möglich sind. Wenn Stammeln und Stocken in den Gedichten an die Wortfindungsstörungen von Aphasikern erinnern, dann auch deshalb, weil Dichter ihnen insofern verwandt sind, als sie ein seltsames Verhältnis zur Sprache haben. Wie sagte Georg Christoph Lichtenberg einmal: „Er konnte die Wörter im Besitz ihrer Bedeutungen nicht ungestört lassen.“
Eine wilde Mischung mutet Schmidt dem Leser zu, keine Frage. Umgangssprache („riss mir den Arsch auf“) trifft auf Fachsprachen, zum Beispiel der Guss-Technik („brammenbrei“), nicht immer überzeugende Kalauer („botschaften / ins boot schafften“) auf Altertümelndes und sinnschwere Erwägungen voller Genitivmetaphern. Als isolierte Reihe betrachtet, wirkten die komisch, ja überambitioniert: „sprachenbrache des erinnerns“, „premienblau der gealterten zeit“, „geschichte der unbrauchbarkeiten“, „pfahl des verzeihens“, „fallbeil der nacht“. Innerhalb der Gedichte selbst treiben sie aber dank der Schmidt’schen Kombinatorik oft genug ganz unpeinliche Bedeutungsblüten. Das hängt natürlich mit ihrer Klang-, Reim- und Neologismenfreude zusammen, die fröhliche Urständ feiert mit „eisschweiß“, „apfelbolero“, „untergedöns“, „funkenluder“, „häftlingin“ und „sensenfräulein“.
Eine übermütige Lust am Überfluss prägt den Band, besonders Gedichte wie „spiegelgedoppelt“:
das zündeln mit haarriss
und hassriss braucht zunder und schwamm
du zeigtest ein feuerzeugnis, die paraffinierte
fintentinte sprach liebe im augenblick
zwischen den tiden des irrens.
So ist Schmidt unterwegs mit dem „fliegenden zeug“ und dem „traumzeug“, durch Wörterwelt, Natur, Eigenleben, Kindheit, Liebesverwicklungen und Stasi-Geschlagenheit. Ihr Humor blitzt nicht nur auf, er wetterleuchtet fast ständig und selbst durch düsterdumpfe Melancholiewolken. Am schönsten vielleicht in den Gedichten, deren Titel schon lächeln lassen: „vokalise geht einkaufen“ und „effendi im effektenfieber“. Vor allem die Extrapolationen des Körperlichen, das Fremdgehen der Gefühle und des Leibes berühren in ihrer kuriosen Präsentation, die wild wechselt zwischen Witz, hohem Ton, erzählerischer Lakonie und beunruhigenden Verunsicherungen.
Farbenreich und musikalisch breitet sich in Blinde Bienen ein Motiv- und Klangteppich aus, dessen Beziehungsreichtum ebenso oft erfreut wie verwirrt. Viele Gedichte weisen einen Rahmen auf oder verweisen aufeinander, manche nähern sich in ihrer Wiederholungs- und Verschiebungsfreude der Minimal Music an.
Das ganze Sprachfahnden erinnert zwar an Schmidts erfolgreichen Roman, ist aber alles andere als bloß eine lyrische Variante von Du stirbst nicht. Ganz ohne biografische Kenntnisse lässt sich in den Versschwärmen ein guter Fischzug tun, ob man sich mehr für die existenziellen Lotungen oder die sprachlustigen Wortflugfische interessiert. Am besten natürlich für beides. Dann kann man sich auch einfach an kühnen Bildern freuen: „wenn die bienen in ihrer / blindheit / am himmel baumeln wie faules gezänk.“
Rolf-Bernhard Essig, Frankfurter Rundschau, 24.2.2010
Auf Taubenfüßen
Kathrin Schmidt, 1958 in Gotha geboren, hat sich als Erzählerin einen Namen gemacht. Mit dem Roman Die Gunnar-Lennefsen-Expedition (1998) wurde sie einem großen Publikum bekannt. Öffentliche Aufmerksamkeit war ihr auch im vergangenen Jahr sicher, als sie für den Roman Du stirbst nicht mit dem Deutschen Buchpreis 2009 ausgezeichnet wurde. Da mag der Hinweis überraschen, dass sie, bevor ihr 1998-er Roman erschien, zunächst Gedichtbände publiziert hat.
Wie so viele aus der DDR gebürtige Autoren, legte sie ihr Debüt 1979 als Posiealbum vor. 1987 und 1995 folgten weitere Bücher mit Lyrik. Standen die letzten Jahre im Zeichen der Prosa, so kann man von Kathrin Schmidt jetzt wieder Gedichte lesen. Blinde Bienen heißt der Band. Die insgesamt 73 Gedichte verblüffen oft schon durch ihren Umfang. Aus dem Sprachmaterial, das Kathrin Schmidt aufbietet, würden andere Schriftsteller gewiss drei Gedichtbände amalgamieren.
Als Lyrikerin hat sie einen verblüffend langen und erkennbar lyrisch frischen Atem. Denn man hat den Eindruck, dass ihr die unverbrauchten sprachlichen Bilder niemals ausgehen. Bei einem großen Teil der hier vereinten Texte handelt es sich um Natur- und Jahreszeitgedichte. Schmidts Verse kommen auf Taubenfüßen: Denn in ihnen wispert und morst, summt und flirrt, fließt und zittert es.
Das Titelgedicht passt zum Herbst. Die Jahreszeit wird im ersten und letzten Vers benannt und bildet dadurch thematisch eine Klammer. Und dass die Bienen blind sind, liegt wohl daran, dass es sich um eine kurze und bündige Alliteration handelt. Wenn der Umschlag aber nicht von Bienen, sondern von drei fliegenden Fischen geziert wird, dann hat das seine Richtigkeit: Denn das Gedicht „es ging um nichts“ hebt mit den schönen Worten an: „nur der fliegende fisch aus dem norden / brauchte beachtung, wie er die ostsee ans mittelmeer heften wollte.“
Der Text „kein böcklicht Männlein“ ist, trotz Negation, eine Erinnerung an das in Arnims und Brentanos „Des Knaben Wunderhorn“ enthaltene Gedicht „Das bucklicht Männlein“, über das Walter Benjamin nicht müde wurde nachzudenken. Das lyrische Ich gibt sich am Ende ebenfalls als märchenhafte Gestalt zu erkennen, wenn es rumpelstilzhaft heißt: „da ist es gut, wenn wirklich nichts und niemand weiß, dass ich im wittchenschnee die / elsenkluge heiß“. Und „im öl der hitznacht“ ist die Beschreibung einer Liebe in einer heißen Sommernacht.
Eines der schönsten Gedichte ist fraglos „Schlüsselfrage“. Das liebevolle Porträt über ein Baby, den „kindskörper“, mündet – dank der doppelten Bedeutung des Verbs „aufziehen“ – in die Verse:
wissen wirst du
schon dass du ihn aufziehen musst oder? der schlüssel steckt.
An den Gedichten von Kathrin Schmidt wird man lange Freude haben. Denn wie jede gute Lyrik, wollen auch diese Texte immer wieder und wieder gelesen sein. Und am besten laut.
Kai Agthe, Neues Deutschland, 3.9.2010
Geisterseher und Abenteurer
In Kathrin Schmidts Roman Du stirbst nicht, der im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde und der die Geschichte einer Lebens- und Sprachwiedergewinnung erzählt, gibt es eine wunderbare Szene. Helene Wesendahl, Schmidts Alter ego, die eine Gehirnblutung erlitten hat und vorübergehend nicht mehr sprechen kann, ringt sich als erstes Wort unter Mühen die Begrüßung ihres Mannes Matthes ab, der sie am Krankenbett besucht:
Sie sagt: He, Mads! oder Mads, gutag! Er versteht es. Er versteht es! Ihr Ehrgeiz ist entfacht. Bist Eulen?, fragt sie ihn. Er guckt. Überlegt er? Ruft plötzlich: Ja, bin Eulen! Ja, ja! Sie könnte nicht Jandl sagen, denkt sie. Nicht Mayröcker. Glück gehabt. Bist Eulen? rutschte ziemlich leicht heraus.
Ein Vers von Ernst Jandl als erster korrekt ausgesprochener Satz: Kann es eine schönere Hommage an die wenn schon nicht lebens-, so doch sprachrettende Kraft der Poesie geben?
„bist frau? bist eulen?“ beginnt auch ein Gedicht in Kathrin Schmidts neuem Lyrikband, das den schönen Titel „effendi im effektenfieber“ trägt (allerdings nicht von der aktuellen Finanzkrise handelt). Sonst aber ist nur noch vereinzelt von der krankheitsbedingten „sprachenbrache“ die Rede. Im Gegenteil: Vergnügt und wagemutig lässt Kathrin Schmidt ihrer Sprachphantasie freien Lauf. Vor allem vermag sie die Wortbildungsproduktivität des Deutschen eindrucksvoll zu nutzen: „sensenfräulein“, „urstromteller“, „körperklangpendel“, „schlupflungenklamm“, „gedachtschneckenspuren“, „wittchenschnee“. Das ist nur eine kleine Auswahl all der Neuschöpfungen und -bildungen, die Schmidts aktueller Gedichtband (es ist ihr fünfter) zu bieten hat. Zwar sind nicht alle auf Anhieb verständlich, aber darum geht es nicht. Gerade die nicht sofort dechiffrierbaren Wörter erzeugen das für die Lyrik so typische Bedeutungsflimmern, den viel dimensional „verdichteten“ Gedichtraum, der aus der Mehrdeutigkeit eine Tugend macht.
Doch diese fast überbordende Lust an der Sprache und ihren Möglichkeiten ist nie Selbstzweck und endet deshalb auch nur in seltenen Fällen – „wie wir stumme botschaften / ins boot schafften“ – im Kalauer. Und gebändigt wird sie durch das erstaunlich strenge Zaumzeug des Verses und verschiedenste Klangfiguren…
Andreas Wirthensohn, Wiener Zeitung, 12.6.2010
Summend nach Seim, nach Sein
− In ihrem Gedichtband Blinde Bienen unternimmt Kathrin Schmidt eine existenzielle Suche. −
Was bedeutet eine Blumenwiese? Seltsame Frage! Eine Wiese ist eine Wiese. Ist eine Wiese ist eine Wiese ist eine Wiese. Und da sind wir schon beim Gedicht. „A poem should not mean, but be“, hat Eliot einmal gesagt, und Gertrude Stein kann dazu nur genickt haben. Englisch und rosenweise. Aber, dürfen kluge Köpfe nun einwenden, Blumen wachsen von selbst. Gedichte hingegen werden gemacht. Blumen sind lebendige Gebilde. Gedichte jedoch, und das haben moderne Poeten selbst immer wieder betont, entstehen aus Kalkulation. „Und Zufall!“, wirft Stéphane Mallarmé ein.
Und Theodor Adorno stimmt zu: „Aber die grossen Kunstwerke sind jene, die an ihren fragwürdigsten Stellen Glück haben.“ Mit Blinde Bienen legt Kathrin Schmidt mutwillig lebendige Sprachkörper vor, die sich genau an dieser Grenze von „gemacht“ und „geschenkt“ bewegen. Konsequente Kleinschreibung vergrössert dabei die möglichen Bezüglichkeiten der einzelnen Wörter, die wie Flimmertiere nach Bindungen suchen.
Ästhetischer Eigensinn
Sicher ist eine Lyrikerin der Moderne dem Intellekt verpflichtet (das waren Lyriker früherer Zeiten auch, sie haben es vielleicht weniger betont), aber die Sprache selbst hat ihre unsinnig summende Energie, kann sich wortwiderständig verweigern oder eben entgegenkommen in Assonanzen, Alliterationen. Und wo ein Vers nicht mit einer direkt übersetzbaren Bedeutung gedeckt ist, da wirkt er über Rhythmus und Klang immer noch als sinnlich ästhetischer Eigensinn. Unvermittelt kann sich die Sternschnuppe einer Idee zeigen, einer Anmut und Zumutung, einer Verwirrung, die anders eben nicht zu haben gewesen wäre. Oder wo gäbe es ihn sonst, diesen „effendi im effektenfieber“? Etwa als orientalischen Herrn mit durch Wertpapieren erhöhter Körpertemperatur? Sicher nicht.
Dieser Effendi wird belebt durch das scharf flimmernde, drängende Wort „effektenfieber“, das ihm seine spezifische Hitze oder Schwüle gibt. Das Gedicht beginnt:
bist frau? bist eulen? – heult
effendi im effektenfieber,
er kann ja nicht verstehen,
dass er nicht sehen darf,
was unterm hemdchen dümpelt.
doch da versteift sich eulenfräulein
auf den zeigesinn, da gimpelt’s
brüstlein vor, zurück, ein stück
effendi gibt sich süss verzaubert.
Und die alte Geschichte von Verlockung, Entzug, Erfüllung beginnt, jedoch in singulärer Erotik und mit Witz, bis endlich vom Wort „portikus“ im finalen „ja“ dem träumenden Effendi sich doch noch der Po zeigt:
und schläfern frau und eulen ihn
schliesslich ein, verliert das nein, das hier
im anzug war. der schwebt jetzt auf die säulen
des portikus hinauf, das aufgeschlaufte
röckchen grüsst von unten mit einem runden
ja.
Kathrin Schmidt beherrscht viele Tonarten. Neben dem neckischen Liebesgedicht steht das anrührend verzweifelte, in dem ein Ich sein „irres lieben“ in immer neuen Bildern und Bewegungen hin zum Du versucht, bis das Gedicht endet:
in falten
leg ich dich und mich. und schreie. schreibe. in einem
fort. dann wieder rückwärts. zugewandt verschmerzen
einander lieb und leib. wie süsse äpfel. verherzen
entzweit. was nicht in eins kommt, nützt nichts. keinem.
Dieses In-eins-Kommen hat für die Autorin, jenseits des Liebesgedichtes, noch eine andere Bedeutung. Im Jahr 2002 erlitt sie eine Hirnblutung. Sie überlebte knapp, musste sich aber auf den komplizierten Weg einer neuen Welterfassung machen. Für ihren Roman Du stirbst nicht, den sie über die Erfahrung der Genesung schrieb, wurde sie 2009 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Schon im Eingangsgedicht „ich häftlingin du“ thematisiert sie den alles verändernden Moment „als mir / smesser aufspringt im täschchen, / die arteria choroidea schlitzt. von nun an / alles. sehr schnell schemen. bruchstück. haft.“ Das Ich steht sich als fremdes Du gegenüber, ist ein Häftling in der Vielzahlhaft der Bruchstücke, die sich zu keiner Identität schliessen wollen.
Die existenzielle Suche nach einem irgendwie wieder heilen Ich, das sprachlich vermittelt sein könnte, ja wohl müsste, durchzieht die Gedichte in immer neuen motivischen und stilistischen Anrufungen. Manchmal werden Versatzstücke von Märchen zu Hilfe genommen wie in „kein böcklicht männlein“, wenn das „alter ego“ nur als „nasser schweifstern, zitternd“, als „kopfmeteorit / noch vor dem einschlag“ Fühlung aufnimmt und letztlich wenigstens in einem vertrauten Zitatenkonglomerat zu einer brüchigen Ruhe kommt:
da ist es gut, wenn wirklich nichts
und niemand weiss, dass ich im wittchenschnee die elsenkluge heiss.
Sprach- und Selbstzweifel
Ein andermal werden ein so unpoetischer Gegenstand wie die Schnabeltasse und das erste schmerzhafte, dünne Trinken zum dichterischen Mund und frühen Sagen („du fasst den tassenschnabel am wunden punkt“), das jedoch noch nicht gelingen will: „aber dein nur beinahe flügges genom sitzt im hinterkopf / fest, während du vielleicht glaubst, es habe den ausweg / endlich gefunden.“ Sprachzweifel, Ichzweifel gehören zu den Grundkonstanten jeder dichterischen Produktion. Und wie Hugo von Hofmannsthal in luzidester Prosa seinen Sprachekel und die Unfähigkeit, noch das Einfachste zu sagen, festhielt, so gelingen Kathrin Schmidt in ihrem summenden, suchenden und fragenden Schreiben frische, nie gelesene Sprachgebilde. Auch wenn oder gerade weil sie im Sinne Adornos nicht an jeder fragwürdigen Stelle Glück hat, wird die Lektüre ihrer Gedichte zu einem wunderbaren Abenteuer.
Angelika Overath, Neue Zürcher Zeitung, 16.6.2010
Tanzende Laute
− Kathrin Schmidts neuer Gedichtband Blinde Bienen zeigt menschliches Verhalten in allen Lebenslagen. −
Kathrin Schmidt ist wieder da. Das ist sie natürlich schon lange – regelmäßig hat sie in den vergangenen Jahren Prosa veröffentlicht, zuletzt den hoch prämierten Roman Du stirbst nicht. Lyrik von der einst mit dem Leonce-und-Lena-Preis bedachten Autorin dagegen suchte man zuletzt vergebens. Mit den über siebzig Gedichten, die der neue Band Blinde Bienen versammelt, sind die prosaischen Zeiten aber nun vorbei: Dieses Buch ist eine wunderbar irritierende Sammlung geworden.
Da ist zum Beispiel das Gedicht über einen „fliegenden fisch aus dem norden“, dessen ambitionierter Plan darin bestand, dass er „die ostsee ans mittelmeer heften wollte“. Selbstverständlich verdient ein derartiges Unterfangen Beistand:
wir stellten ihm
virtuell wasser zur seite, damit er auf seinem flug den gesetzen
zu folgen lernte, die wir uns ausgedacht hatten.
Doch während man noch grübelt, in was für eine Unternehmung man da gerade hineingezogen wird, kommt die Sache bereits in einem famos-melancholischen Schlusspanorama an ihr Ende:
vor venedig stürzte inzwischen gewittrige seide vom himmel,
zu viel fürs netz, das sofort kollabierte, der fisch verschwand,
wir konnten noch eine weile das nachbild des zerrissenen
heftfadens sehen, wie es über den schönen alpen schlingerte.
Dergleichen ließe sich als psychedelischer Nonsense verunglimpfen oder bejubeln, es lässt sich als tiefschürfende Allegorie, als sinnschweres Bild deuten – was in jedem Fall zurückbleibt, ist das wunderliche Gefühl, hier habe jemand etwas Ungebärdiges mit der Sprache angestellt.
Unter Mischwesen
Einfach bändigen lässt sich allerdings kaum eines der Gedichte in Blinde Bienen, obgleich sie thematisch durchaus vertraute Sujets umkreisen: Natur, Kindheit oder Zwischenmenschliches, insbesondere die Liebe. Kathrin Schmidts poetische Kunst besteht vielmehr darin, für konventionelle Themen eine Form zu finden, in der sich Irritationen austoben, gelegentlich auch nur subtil entfalten können. Sinnfällig wird dies immer dort, wo die Laute zu tanzen und die Bedeutungen zu flirren beginnen. Dann entstehen aus Worten wie „wispermohn“ und „whispermoon“, wie „bleigesicht“ und „gleichgewicht“, wie „saum und sander, zaum und zander“ surreale Gebilde: „räume, in denen es ordnungen schneit“, wie etwa in jenem „museum / der abgehalfterten dinge“, in dem sich „sorgenstern“, „milchfädchen“ und „ungefeuer“ versammeln.
Solche Sprachräume bereiten immer wieder die Bühne für merkwürdige Wesen. Menschen und nicht selten Tiere – wie „eine zweifach gebeutelte asylwölfin“ („sie lüpfte / einen der beutel für mich. / im andern warst du, ich lernte dich fühlen durchs fell“) oder einfach ein „sprechendes rehtier“ – treten dort auf, beobachten einander, treten zueinander in Beziehung. Dabei wird stets eine leicht distanzierte Außenperspektive gewahrt; Innenschau bleibt aus, die Bilder müssen für sich sprechen:
von himmelsfetzen gänzlich bedeckt, lagerten wir
in imaginärer tundra. kann sein, dass es das
war
was permafrost auslöste. was dir den eisschweiß
auf die stirn trieb.
Auf diese Weise entstehen präzise Skizzen zumeist intimer Verhältnisse – Skizzen, die zwischen den Handelnden einen Raum des Unaufgelösten belassen:
ganz nass stehen jetzt
mann und frau beieinander und wissen nicht,
welche verfahrensregeln sich abkoppeln müssen
in diesem verstummspiel, diesem scheidegescheiten
streiten um höhen und tiefen.
Immer sind in solch unentschiedenen Momenten Verletzung und Geborgenheit gleichermaßen möglich.
Historische Tiefe erhalten diese Studien menschlichen Verhaltens nicht zuletzt dort, wo sie von einer Sozialisation in der DDR erzählen – biografisch grundierte Texte, in denen die 1958 im thüringischen Gotha geborene Autorin Erinnerung und psychosoziale Studie verbindet, eröffnen den Band. Ganz am Anfang jedoch steht ein Gedicht über jene grundstürzende Irritation, von der Kathrin Schmidt bereits in ihrem letzten Roman erzählte, die Hirnblutung:
als mir
s messer aufspringt im täschchen,
die arteria choridea schlitzt. von nun an
alles. sehr schnell schemen. bruchstück. haft.
Seit sie im Jahr 2002 von einer solchen Hirnblutung aus dem Leben, aus der Sprache gerissen und in „bruchstück. Haft“ genommen wurde, war kein Gedichtband von ihr mehr erschienen. „Gedichte? Wie geht das? Sie kann es sich einfach nicht vorstellen“, hieß es im Roman über Kathrin Schmidts Alter Ego Helene Wiesendahl. Blinde Bienen nun lässt keinen Zweifel mehr daran, dass eine der eigenständigsten Lyrikerinnen ihrer Generation wieder weiß, wie das geht mit den Gedichten.
Peer Trilcke, Literaturen, Heft 2, 2010
Dem Frühling das Herz zeigen
− Eher in kleinen Dosen zu genießen, weil dem Eigensinn verpflichtet: Die Gedichte von Kathrin Schmidt. −
Prosa, die sich erinnert, ist erklärungspflichtig. Aber das Gedicht bietet die Chance, zu erzählen und dabei doch verschämt auszusparen. Kathrin Schmidt, 1958 in Gotha geboren und im vergangenen Jahr Trägerin des Buchpreises, nennt, was von ihr und ihrem Bruder während ihrer frühen Jahre in der DDR Besitz ergriff, schlicht „das eine“. Zusammen saßen sie hinterm Gebüsch und dachten, wenn sie die Augen schlössen, wären sie für ihr Gegenüber unsichtbar.
aber das eine sah uns sehr wohl,
seine arme streckte es aus nach uns, dass nichts ausblieb,
nicht das geknotete blautuch, der eid auf die fahne
oder das alte schweigen.
Die Mitgliedschaft bei den Jungen Pionieren wäre demnach gänzlich bloß ein ihr Angetanes gewesen? Dem Bruder erging es schlimmer als ihr,
das eine
versuchte mich nicht, umgarnte den bruder (…)
zockte
den ehrenmann ab, die berichte flossen nur so.
Also informelle Mitarbeit bei der Stasi ist dem Bruder offenbar zugestoßen. Dann aber räumte „das eine“ das Feld, es kam „das andere“, „mein bruder / zerbrach.“ „Ihm blieb nur / mein schädelfach, das der gespaltenen ehre.“
Was es mit einem Ding wie der gespaltenen Ehre auf sich hat, dem würde man doch gern auf den Zahn fühlen. Aber hier übt das Gedicht sein Vorrecht des Rätsels aus. Manchmal scheint Kathrin Schmidt hin- und hergerissen zwischen dem, was sie verschweigen, und dem, was sie sagen möchte. Ein Gedicht kann beginnen:
Ich habe birnen gekauft, sie duften
unter der achsel hervor, aus dem
beutel, du könntest sie,
wenn du nur wolltest, erraten.
Das ist ein schöner Anfang: Die Birnen sind reale eingekaufte Früchte, doch zugleich unbestimmt hoffnungsvolles erotisches Gleichnis, dem notorischen Apfel durch Vieldeutigkeit überlegen. Doch dabei läßt Schmidt es nicht bewenden. Das implizite Angebot wird vom Mann, der ihr den Beutel abnimmt, stumpf verkannt; und dieses lyrische Ich kann es sich nicht verkneifen, leicht beleidigt zu schließen:
hättest du birnen erraten, wären wir
schwimmen gegangen im süßen saft, wir wären
beide behände delphine gewesen, denen der abend nichts anhaben kann.
Damit jedoch werden die Birnen jäh zum überdeutlichen, klatschnassen Symbol, das zudem das Mißliche an sich hat, kraft der Delphine, welche das Meer vertreten, süß und salzig zugleich sein zu müssen: Da hat die Verfasserin ihre Metapher nicht genug angeschaut.
Man kommt mit diesen Gedichten am besten zurecht, wenn man sie nicht als ganze, sondern in Versgruppen zu sich nimmt; denn sie fallen, ihrem komplexen Bauwillen zum Trotz, doch oft auseinander in gelungene und minder gelungene Partien. So heißt es vom Frühling:
noch reden
die vögel amharisch, ich kann sie
so schlecht verstehen. verstehe sie aber gut, wenn
sie der kirsche unter die haut gehen, die birke
bevölkern. wenn sie dem frühling ihr herz zeigen.
Die untertunnelte Haut der Kirsche, das Herz der Vögel, die poetisch und praktisch zugleich erfahren – das ist ganz wunderbar. Jedoch wird der Frühling selbst unmittelbar darauf als ein verstörter, buckliger Wal eingeführt, im Garten gestrandet; die Vögel wollen ihn retten, „zerren den wal aus dem schlick und werfen ihn an den himmel.“
Wie, bitte, soll das sinnfällig vor sich gehen? Hier existiert überhaupt kein tertium comparationis mehr, sondern bloß noch abstruse Willkür uneigentlichen Sprechens. So läuft das überall. „Mainächte, nach denen die schnorrer geben“, stärker kann man die entselbstende Gewalt dieses Erlebnisses wohl nicht in eine Zeile bringen. Doch warum in aller Welt müssen sie, die Mainächte, „verkehrt herum aufgehängt“ sein? Von den titelgebenden blinden Bienen heißt es, dass sie „am himmel baumeln wie faules gezänk“, wodurch in ziemlich einmaliger Weise mehr Licht vom Verglichenen auf das Vergleichende fällt als umgekehrt: plötzlich hört man es, dieses faule Gezänk, an das man vorher wahrscheinlich nie dachte. Doch treiben im selben Gedicht leider noch andere Insekten ihr Wesen, ein Paar Kastanien-Miniermotten, die aus unerfindlichen Gründen mit dem Wir dieses Gedichts identifiziert werden.
Geringe Widerstandskraft besitzt Schmidt auch gegen den Kalauer. Den Übergang von Sommertag zu Sommernacht durch den von „Wispernmond“ zu „whispermoon“ zu verklammern – geht das? Man zweifelt, man prüft; und stellt mit einigem Bedauern fest, dass der Sprung vom Deutschen zum Englischen das Sprachbild entscheidend beeinträchtigt. Schmidt neigt dazu, das einzelne seltene Wort stark anzuspannen. Dass es sich beim „filzigen herzgespann“ (diese Pflanze gibt es wirklich!) um einen „lippenblütler“ handelt, rettet den Strukturkern des Gedichts selbst dann nicht, wenn sie dem Leser mit dem Zaunpfahl der Kursivierung winken.
Aufschlussreich ist, welches Schicksal bei Kathrin Schmidt der Reim erfährt, an dem sie sich wiederholt versucht.
(nabe)
um nabe stockt, der wagen bricht. mein irres lieben
geht aus dem leim. versuppt. verschleimt. Bleibt nur das hoffen
auf offnes, deinerseits. mir wächst ein bart, besoffen
stehn die haare ab. die Zähne. was, wenn blieben
(nur die wechsel…).
Das Dilemma, das sich hier auftut, ist wahrlich nicht nur das der Autorin. Damit der Reim wirkt, muss das Gedicht mit einer gewissen Grundgeschwindigkeit voranschreiten, denn sonst hat der Leser, wenn er am zweiten Wort, dem Echo, anlangt, das erste, den Ruf, schon vergessen. Schlägt er aber diese Geschwindigkeit ein, versteht er nichts mehr vom anspruchsvoll verschlüsselten Text. Man kann über diese Reime hinweglesen, ohne sie auch nur bemerkt zu haben: so sehr hat sich ihre Kraft im Handgemenge mit dem auch rhythmisch knorzigen Eigensinn des Inhalts geschwächt. Es nimmt dem sinnlichen Verlust das Maß, den die Lyrik erlitt, als sie sich vor rund hundert Jahren entschloß, das süß Konventionelle von sich zu tun und auf die herbe Originalität zu setzen.
Burkhard Müller, Süddeutsche Zeitung, 22.10.2010
Frisch von Erscheinung!
− Kurze Beobachtungen-Inventur zu Kathrin Schmidt: blinde bienen, Gedichte. −
blinde bienen, das sind erratische Zaubereien (wie) aus dem Schnürboden zwischen Ich und Welt. Gegeben werden „stunden süßer boykotte“ und leicht dahin gespielte Modifikate sprachlicher Standards, „wittchenschnee“, und mit metaphorischer Chuzpe gebaute Edelseltsamerien. „in dieser situation lief eine zweifach gebeutelte asylwölfin durch die bildlichtung“. Prismen plötzlicher Frappanz, hapaxlegomenale Pressungen, man staunt und versucht, sich „konturdamen“ und „haftschwager“ einzuverstehen, einzuverwundern. „im planquadrat des verzeihens“. Beschreibungen zerriebener Beschreibung. Im flirrlichternden Atlantiszirkus jenseits der reinen Ratio. Hermetographien, leuchtend. „warnflaggenleuchten“. So ist das Gedicht, wenn der Weg labyrinthisch. Eine schön verunordnende Ordnung. Arbeit an der Perplexrezeption. Wahrnehmungsanfänge und -teilstücke und eine in sich verkantete, verschmierte Logik. „kleine diagnosesplitter“, Fiktionspartikel. Ein Ich dazwischen, das kreativ taumelt, als zwangsläufiger Magnet seiner visuellen, sprachlichen und emotionalen Nahrungsaufnahmen.
so ungefähr
schwankt das schon lange. so ungefähr habe ich mich erwartet
mein betörendes zaudern vor dem feind, die kleine frequenz
auf zielgerader strecke.
Unbändig, grenzgängerisch, reich an Trotzpartikeln gegen die Herkömmlichkeiten sprachlicher Standortbestimmung. Souverän haltlos, dieses so unselbstige Selbst.
dein schlafen
war nichts als ein notbehelf
Poesie, wie sie nur zu gern sein darf: das große Vielleicht, gleißende Gleichzeitigkeit.
Ron Winkler, 23.3.2010
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Herbert Wiesner: Im Wort Karten Haus
Literarische Welt, 27. 2. 2010
Astrid Kaminski: Tonspuren im Untergedöns
Berliner Zeitung, 14. 5. 2010
„Ich fühle, dass ich noch voller Geschichten bin…“
– Kathrin Schmidt im Gespräch mit Jürgen Verdofsky. –
Jürgen Verdofsky: Gespräche über Lyrik bewegen sich immer unter ihrem Anlass, sie sind eine Verlegenheit, ein Notbehelf, im besten Fall eine Brücke zu jenen, die Gedichte lesen. – Das Erlebte, die Realität an sich genügt niemals, auch nicht in Ausnahmefällen. Aber sehen Sie zwischen Lyrik und Prosa den Unterschied, den zuletzt Burkhard Müller anführte, Prosa sei „erklärungspflichtig“, das Gedicht aber nicht? Im Gedicht liegt Freiheit. Nichts muss so sein, wie es scheint. Oder stimmt das gar nicht, braucht das Gedicht doch „kleine Vernunftschneisen“?
Kathrin Schmidt: Die Prosa halte ich auch nicht für so geheimnislos oder für unbedingt „erklärungspflichtig“. Mir gefällt schon, dass der Prosatext auch sein Geheimnis hat. Aber was das Gedicht vom Prosatext unterscheidet, da kommen wir vielleicht auch auf diese Sache von Burkhard Müller zurück, ist erst mal, dass ein Prosatext nicht nur eine Momentaufnahme ist, jedenfalls für mich nicht. Selbst wenn er nur einen Moment beschreibt, so sieht er ja eine Sache von verschiedenen Ecken und breitet sich darüber in einer längeren Weise aus, als es ein Gedicht kann.
Ich finde, als beste Gedichte von mir, für mich, stehen solche, die nur kleine Momentaufnahmen sind. Wo sich praktisch die Realität und das, was man im Kopf hat, aneinander reiben, einander begegnen oder vielleicht ganz kleine Punkte haben, wo sie ineinander übergehen oder verschmelzen. Aber das kann man dann auch gar nicht so richtig ausmachen, und eine Momentaufnahme ist für mich eigentlich das Gedicht, wo Ströme fließen, die nicht erklärbar sind. Man nicht weiß, wo sie herkommen und wo sie hingehen, was aber wirklich nur auf den Moment bezogen ist. Das ist mir das Wichtigste und Schönste am Gedichteschreiben.
Verdofsky: „Wenn man etwas von den Bäumen pflückt“, so haben Sie das mal genannt. Die Idee, die Eingebung, ein Vers ist im Kopf, man hat vielleicht schon einen zweiten, es fehlt der dritte, der vierte ist wieder da. Wann setzt die Strenge der Form ein?
Schmidt: Das geht bei mir eher in eins. Ich habe selten einen ganzen Vers im Kopf. Meistens nur ein besonderes Wort oder ein Wort, das sich an seinen Vokalen dann nochmal spiegelt und ein anderes Wort ergibt. Und ich schreibe dann einfach drauflos. Da ich nicht davon ausgehe, dass meine Gedichte einem strengen Sinn folgen, sondern ich das, was man jetzt Sinn nennt, oftmals erst hinterher aus dem Gedicht überhaupt herauslesen kann, ist eigentlich die Form für mich während des Schreibens fast das Primäre.
Ich beginne mit dem Wort, mit dem Klang und sehe am Ende, was sich da für ein Sinn ergibt. Ändere dann manchmal noch in Richtung auf diesen Sinn etwas um. Das ist ein Prozess, in dem sich das verzahnt und ineinander übergeht. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Gedicht, das am Anfang für mich mit einem beschwingt zu nennenden Wortspiel beginnt, wenn ich’s mir am Ende anschaue, meinetwegen Tod und Teufel zum Inhalt hat.
Verdofsky: Diese tragikomischen Züge halten die Gedichte offen, auch in der Andeutung. Zwischen den Versen zeigt sich manchmal ein Lächeln, ein Wortwitz, das Tragische aber auch. Das ist ein großer ästhetischer Ertrag, doch das Gedicht gelingt nicht im Handstreich. Sie arbeiten formbewusst, es gibt schon früh den Daktylus. Wann ist ein Gedicht für Sie fertig?
Schmidt: Der Daktylus sitzt einfach tief in mir drin, das ist schon seit meiner Kindheit so. Und ich krieg das auch gar nicht mehr los. Ich muss das auch manchmal ändern und aufbrechen, weil es mich dann schon stört. Aber ich spreche mitunter tatsächlich im Daktylus, ich merk das dann gar nicht (lacht).
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Mein Schreiben vor dem Platzen des Aneurysmas unterscheidet sich sehr von dem Schreiben danach. Vorher habe ich ein Gedicht einfach im Kopf verfertigt, es war abgeschlossen in dem Moment, da ich es aufschrieb. Ich habe mich gar nicht an den Computer oder ganz früher an die Schreibmaschine setzen müssen, um ein Gedicht zu schreiben. Das entstand einfach so nebenbei, während ganz anderer Tätigkeiten.
Das funktioniert nun halt nicht mehr. Jetzt arbeite ich schon länger an einem Gedicht am Laptop. Ich lese es mir vielleicht zwei-, dreimal vor, habe dann ein Gefühl und das trügt mich selten. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es fallen auch sehr wenige Gedichte dann beim Lektorat eines Bandes nochmal raus, die verwerfe ich dann meistens auch von mir aus. Ich vertraue meinem Gefühl und möchte mir eigentlich keine Rechenschaft darüber ablegen, woran ich das festmache.
Ich denke, dann wäre die Selbstzensur zu groß. Ich lass das schon eher in dem Rahmen, in dem ein Gedicht möglicherweise auch seine Wirkung entfaltet, ohne vage zu sein. Einfach dieses Berühren von Realität und Kopf, diese kleinen Momentaufnahmen.
Verdofsky: 2002 hatten Sie nach einer Hirnblutung, einem geplatzten Aneurysma, um Ihr Sprachvermögen zu kämpfen. Was ist, wenn das wahre Leben vorüber zu laufen scheint, zum Greifen nahe, und die Worte fehlen, wie es Helene Wesendahl in Ihrem Roman Du stirbst nicht erfahren muss. Zur Situation gehört, jedes Wort wiederfinden zu müssen. Was hat sich da verändert? Ein neues Vertrauen in wiedererworbene Worte? Eine Skepsis gegenüber einer Leichtigkeit von Metaphern?
Schmidt: Tja, was ist da anders? Wenn ich mich jetzt beim Gedichteschreiben beobachte, sehe ich dieses schwarze Loch, das mich 2002 befallen hatte, so ja nicht mehr. Es ist nun schon wieder ganz schön gefüllt worden. Ich habe bei meinem eigenen als auch dem Schreiben anderer gegenüber nicht mehr diese Not, die ich nach dem geplatzten Aneurysma hatte. Ich konnte überhaupt nichts verstehen, ich habe Bücher Seite für Seite, Satz für Satz wieder und wieder gelesen und nichts begriffen. Es ging einfach nicht. Jetzt würde ich sagen, dass ich das wieder habe ausgleichen können und sehe auch keinen zu großen Unterschied gegenüber früher. Wenn ich erzähle, wie ich dahin gekommen bin, wirft das vielleicht ein Licht auf den Prozess.
Es war so, dass ich 2007 zu einer Lyriklesung nach Greifswald eingeladen war. In jenem Jahr hatte ich überhaupt noch keine neuen Gedichte und kam nun mit meinem Band GO-IN der Belladonnen an, während die anderen alle brandneue Sachen lasen. Da waren Gerhard Falkner, Ron Winkler und Ulrike Almut Sandig. Und die lasen und lasen. Ich las natürlich auch und machte keine schlechte Figur damit. Aber für mich war das natürlich alles alter abgegessener Quark und neue Gedichte kamen nicht. Ich fühlte mich sehr unwohl.
Am meisten habe ich mich erregt gefühlt durch die Lesung von Ron Winkler, weil ich da auch schon semantisch vieles überhaupt nicht verstand. Schon die Worte nicht, er macht ja oft solche Synthesen aus Fremdwörtern und metaphorischen Elementen, das geht bei ihm so ineinander über. Ich begriff die Machart absolut nicht. Wir sind dann zusammen nach Hause gefahren und ich hab ihm das auch gesagt. Ich habe mir danach jedes seiner Bücher gekauft, das ich kriegen konnte, wollte ihn einfach knacken. Und habe von morgens bis abends Ron Winkler gelesen, weil ich wissen wollte, wodurch diese Erregung kam, die mich erfasst hat, als ich ihn gehört habe.
An dem Tage, an dem ich das Gefühl hatte, jetzt hast du Ron Winkler geknackt, war das wie eine Befreiung. Dann strömten und purzelten die Gedichte, zwar nicht so, wie ich es von davor kannte, aber es kamen tatsächlich wieder erste Gedichte. Das fand ich ganz großartig, hatte ein richtiges Aha-Gefühl, und es war mir klar, ja, so macht er das und so kannst du auch deinen Weg wieder finden zum Gedicht. Ein ganz einschneidendes Erlebnis, zu dem mir Ron Winkler verholfen hat, das fand ich einfach irre.
Verdofsky: Kreative Erregung, nur durch Lektüre entstanden. Weiß Ron Winkler davon?
Schmidt: Ich hab’s ihm wohl mal geschrieben, aber wir haben uns neulich in Edenkoben getroffen, da machte er nicht so den Eindruck. Wir haben dort gelesen und ich sagte, ich lese einfach mal die zwei Gedichte aus dem Band, von denen mir immer gesagt wird, dass niemand sie versteht. Ron Winkler kam hinterher zu mir und sagte, also ich verstehe die Gedichte sehr gut, die sind ja geschrieben wie meine. Das fand ich Klasse, weil das nämlich auch die beiden Gedichte waren, die im Reflex auf ihn entstanden waren. Er weiß vielleicht gar nicht mehr, welche Bedeutung er für mich hatte.
Verdofsky: Welche Gedichte waren das?
Schmidt: Das waren „gültiger laufpass“ und „retrospektiv“, diese beiden habe ich gelesen. Und das waren auch tatsächlich Gedichte, die unmittelbar im Anschluss an die Ron-Winkler-Lektüre entstanden sind. Ich war im Frühjahr 2008 in Wefelsfleth, als die ersten Gedichte entstanden. So manches Mal habe ich dort bei mir gedacht: Siehste, nun habe ich’s doch geschafft, Dich zu knacken.
Verdofsky: Bei Ihnen fällt mir ein frisches Beatmen der Sprache auf. Es zeigt sich auch durch Wortfindungen, die aus den Gedichten heraus leuchten, wenn man liest: „mundartmündel“, „schallmauerblumen“, „saufschlaufen“, „fintentinte“, „schlupflungenklamm“. Eine Belebung der Sprache durch ungewöhnliche Zusammenfügungen oder leichte Verfremdungen als Stilmittel.
Schmidt: Das kommt wirklich aus dem Bauch. Sie finden das sicher auch schon in meinen ersten Gedichten. Aber es geht nicht mehr von selbst, so spielerisch, wie vor dem Aneurysma. Es passiert, und wenn es passiert, dann bin ich auch sehr froh drüber. Aber zum Beispiel im Gedicht „blinde bienen“ ist diese Zeile „wenn die bienen in ihrer blindheit / am himmel baumeln wie faules gezänk“, ja frei von jeder Worterfindung. So etwas ist bei mir jetzt, glaube ich, eher präsent als neue Wörter.
Verdofsky: Sprache wird in der Kindheit geprägt, an welchen kindlichen Sprachalltag erinnern Sie sich?
Schmidt: Sprache war für mich von Anfang an das Element. Ich habe schon als Kind immer alles mit mir im Stillen und schreibend abgemacht, lautmalerisch auch. Ich konnte mit meinen Eltern nicht über Themen sprechen. Das hatte auch damit zu tun, dass auf meiner Mutter diese schlimme Fluchtgeschichte aus Königsberg lag und mein Vater eine lange Haftzeit in Bautzen hatte. Irgendwie haben die sich immer gegen alles gesperrt, was mich interessiert hätte, politisch haben sie sich überhaupt nicht geäußert. Abläufe wurden besprochen, aber nicht Themen. Mich interessierte doch aber so vieles! Ich musste Klavierspielen lernen und habe mich immer hingesetzt und die Finger mechanisch spielen lassen, der Kopf ging spazieren.
Als kleines Mädchen habe ich schon erste gereimte Dinger abgelassen. Mein Vater hat mit mir immer Wortspiele gemacht, auch als Reflex auf seine Haftzeit, wo es ihm offenbar beim Überleben half, so etwas zu tun. Wörter rückwärts lesen zum Beispiel, das konnte ich dann auch ziemlich schnell. Er hatte viele kleine Reime parat, Abfolgen von Stabreimen, irgendwelche Gedichtchen oder Sprüche. Er kannte Unmengen davon und hat mir das schon als kleines Kind beigebracht, so dass es in meinem Kopf ständig gesummt hat. Ich glaube, das war sehr prägend. Ich war meinem Vater auch ziemlich nahe, viel näher als meiner Mutter, vielleicht weil sie immer durch andere Sachen okkupiert war. Mein Vater war zuweilen zu meiner Betreuung regelrecht abgestellt worden von ihr.
Verdofsky: Es gibt schöne Beispiele für Sprachnonsens in dem Roman Du stirbst nicht: „Drei Mädchen warten im Garten.“ Oder auch „Den Boxermeister hauen wir zu Kleister“ – Sie sind über die Lyrik zur Literatur gekommen, haben zuerst, und dann lange, nur Gedichte geschrieben. Auch bei Ihrer ersten Prosa merkt man deutlich, hier schreibt eine Lyrikerin. Viele Metaphern, eindringliche Sprachbilder, verblüffende Wortfindungen. Mit diesem Effet der Worte gab es einen Übergang zur Prosa. Nach der Erkrankung 2002 sind Sie einen entgegengesetzten Weg gegangen. Die kleinen Versatzstücke der Sprache, die mit anderer Bedeutung aufgeladen wurden, mit neuem Erlebnishintergrund, fügten sich jetzt schwerer zum Gedicht. Eine geschlossene Geschichte zu erzählen, einen Roten Faden zu haben, wurde zum rettenden Weg?
Schmidt: Dass ich zunächst einen Roman geschrieben habe, war das Einzige, was mir möglich war: Seebachs schwarze Katzen. Es war eigentlich mein therapeutischer Roman. Den habe ich ein halbes bis dreiviertel Jahr nach dem geplatzten Aneurysma begonnen. Ich bin noch sieben oder acht Mal am Tag eingeschlafen, hatte immer nur ’ne halbe Stunde bis Stunde zum Schreiben und hab’ ihn trotzdem fertig gekriegt. Heute scheint es mir fast egal, damals natürlich nicht, ob er gut oder schlecht ist. Als der Verlag ihn druckte, fand ich das großartig. Für mich steht der Roman als Zeichen dafür, dass ich es irgendwie geschafft habe, mich aus diesem Loch langsam wieder heraus zu bewegen. Da kann er klappern und wackeln, Luft haben, wie er möchte. Es war ein ganz konzentriertes Dranbleiben am Roten Faden dieser Handlung. Ein Gedicht wäre absolut unmöglich gewesen in dieser Zeit, Prosa ging so halbwegs. Ich war richtig erstaunt, als alles fertig war. Wenn ich das nicht gehabt hätte…
Verdofsky: Der Erzähler arbeitet auf einen Punkt hin, hat eine Geschichte, die er verfolgt. Das kann er ausweiten oder wieder beschränken. War es diese Freiheit gegenüber dem Moment-Gewitter eines Gedichtes, die nach einem Roman verlangte?
Schmidt: Bei mir gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Schreiben von Romanen und dem Schreiben von Erzählungen und Lyrik. Erzählung und Lyrik sind für mich vom Entstehungsprozess her sehr ähnlich. Ich beginne auch, wenn ich eine Erzählung schreibe, nicht mit einem Roten Faden oder mit dem, was in der Geschichte passieren wird. Ich beginne mit irgendeinem Klang, mit einem Satz, der mir gefällt und spinne den weiter. Irgendwann kommt dann eine Handlung dazu, die zum Ton und zu der Wahl der Worte passt, ob das nun schwere oder leichtfüßige Worte sind. Dann überlege ich mir, in welche Richtung könnte sich das inhaltlich entwickeln. Es gibt dabei große Parallelen zur Lyrik, dort läuft das jedoch noch viel konzentrierter ab und man ist auch schneller fertig als mit einer Erzählung. Aber vom Schreibprozess her ist es sehr ähnlich, bei mir zumindest.
Beim Roman hingegen ist das anders. Da möchte ich schon wissen, wie er endet, das ist immer das Wichtigste. Zum Beispiel war es ja auch bei Du stirbst nicht so, dass ich gar keinen Roman schreiben wollte. Ich hatte einen Krankenbericht geschrieben von dreißig Seiten und wollte den eigentlich in die Schublade packen. Den Bericht habe ich einer Freundin geschickt. Sie war es, die gesagt hat, wenn du die erste Seite zur letzten machst, kann daraus ein wunderbarer Roman werden, in dem die Protagonistin zu dem Punkt zurückkehren muss, da das Aneurysma platzte. Sozusagen als Schlusspunkt hinter die Wiedergewinnung der eigenen Existenz, der Erinnerung, der Sprache.
Das leuchtete mir sofort ein, und in diesem Moment habe ich beschlossen, einen Roman zu schreiben. Der Schluss muss immer irgendwie greifbar sein. Das ist das Entscheidende, und das unterscheidet einen Roman während des Schreibens auch maßgeblich von Lyrik oder Kurzprosa.
Verdofsky: Das hieße aber auch, dass zur Kurzprosa wie auch zum Gedicht eine Pointe gehört. Die Erzählung „Der Kirschgott“ läuft mit allen tragikomischen Zügen auf eine starke Pointe zu. Inhaltlich hat mich das an Christoph Heins Horns Ende erinnert, das ist aber ein Roman, der keine Pointe braucht. Ihr Erzählungsband Finito zeigt, dass es zwischen dem Gedicht und der klassischen Kurzgeschichte doch mehr Verwandtschaft gibt, als man ahnt.
Schmidt: Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Ich habe ja nicht Germanistik studiert oder etwas ähnliches und bin heute auch sehr froh darüber. Was die Regeln für eine Geschichte betrifft, könnte ich Ihnen überhaupt keine Auskunft geben, weil ich mich damit nie beschäftigt habe und das überhaupt nicht weiß. Natürlich habe ich Geschichten gelesen und es bleibt ja nicht aus, dass man dann auch einen inneren Maßstab dafür übernimmt. Aber das habe ich nie ins Bewusstsein gehoben oder nie zugelassen, dass es bei mir ins Bewusstsein dringt. Es ist immer stark von meinem eigenen inneren Gefühl der Geschichte gegenüber abhängig, ob ich sie durchgehen lasse oder nicht.
Verdofsky: So verfährt ja eigentlich jeder Künstler. Das ist auch nicht Teil der vergleichenden Literaturwissenschaft, zumal die Gattungen sich in der Theorie voneinander entfernen. Es gibt auch kühne Einwürfe: Ein Erzähler, der eine gewisse Höhe erreicht habe, verstumme als Lyriker. Ingeborg Bachmann wird dann immer angeführt. Wie es auch große Lyriker gebe, und schon fällt Benns Name, die es nie zu einem Roman gebracht haben. Das kommt natürlich alles vor, aber ich halte das für zu puristisch. Die Übergänge sind interessanter.
Schmidt: Es geht sogar soweit, dass ich aus einem Gedicht die Idee zu einem Roman ziehen kann. Zum Beispiel in meinem Gedichtband Flußbild mit Engel beginnt das letzte Gedicht so:
Als wir den Flickenteppich aus allerhand Wirklichkeiten
über die Körper gelegt hatten,
wollte uns nichts mehr gelingen.
Es ist ein altes Gedicht von 1985/86. Das habe ich geschrieben, noch als richtige DDR-Bürgerin, als Reflex auf Gorbatschow. Weil Gorbatschow für mich anfangs ein Hoffnungsträger war, auch in der Art und Weise, wie er alles verband.
Ich begriff auf einmal, dass alles mit allem zusammengehört. Es gibt nicht auf der einen Seite die Guten und auf der anderen die Schlechten, die Trauer oder die Fröhlichkeit, sondern es gehört alles zusammen. Und als ich dieses Gedicht geschrieben hatte, kam mir die Idee für Die Gunnar-Lennefsen-Expedition. Ich wollte einen Roman schreiben, in dem sozusagen alles mit allem korrespondiert und alles von allem abhängig ist. So kann es sogar sein, dass einem durch ein Gedicht die Idee zu einem Roman kommt.
Verdofsky: Aber man erkennt noch die Lyrikerin. Die Gunnar-Lennefsen-Expedition ist voller Metaphern.
Schmidt: Da war ich ja auch noch nicht geübt in der Prosa.
***
Verdofsky: Geschichten, die nicht erzählt werden, gehen verloren – am Ende sind sie nicht einmal geschehen. Gibt es Geschichten, bei denen Sie eine stille innere Aufforderung verspüren, Sie müssten diese erzählen?
Schmidt: Ja, sowas habe ich schon gespürt, sowohl bei der Gunnar-Lennefsen-Expedition als auch bei Koenigs Kinder. Ich habe mehr oder weniger instinktiv gespürt, dass das Stoffe sind, die ich gerne bearbeiten würde. Die Herkunftsgeschichte meiner mütterlichen Linie aus Ostpreußen war mir sehr wichtig. Weil es immer ein Tabu in meiner Kindheit war, hat mich das sehr beschäftigt. Ich bin froh, dass ich es schreiben konnte, jenseits der Wende, vorher wäre es nicht gegangen. Aber ich komme bei alledem von selbst nicht auf den Gedanken, ich sag’s mal übertrieben, dass nur ich das ausdrücken könnte. Dieser Gedanke hat mich noch nie geleitet beim Schreiben.
Verdofsky: Das Gedicht kann im Gegensatz zum Roman aus allen Zusammenhängen heraustreten und ist dann der Deutungskraft des Lesers bedeutend mehr ausgesetzt.
Schmidt: Ja, nicht nur das. Es kann mit seiner Lebenssituation zusammenhängen. Lebt jemand in Trennung, liest er das Gedicht völlig anders und bezieht es auf seine eigene Situation, als jemand, der meinetwegen gerade ein Fußballtor geschossen hat. Es kommt hinzu, dass die Situation des Lesers auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit dem Text korrespondiert. Das Gedicht kann sich sogar wie ein Chamäleon an die Situation des Lesers anpassen, ohne dabei nun vage, beliebig oder missdeutbar zu sein, einfach weil es ja für sich steht. Ich bin da auch noch nicht am Endpunkt, vielleicht ist es ja ein Irrweg, dass man davon ausgehen kann. Aber das interessiert mich im Moment.
Verdofsky: In der Rezeption des Lesers tauchen auch Dinge auf, die beim Lyriker keine Rolle gespielt haben. Bilder werden anders genutzt, weil der Leser bisher dafür keine Worte hatte und plötzlich geht ihm was auf. Ist das irritierend, wenn Sie bemerken, dass Lesarten entstehen, von denen Sie selbst entfernt sind?
Schmidt: Nein, bei Gedichten irritiert mich das in keiner Weise, das finde ich legitim und sogar meist spannend. Es bringt mir was. Wogegen ich bei Prosa bei manchen Lesarten sehr empfindlich bin. Zum Beispiel Du stirbst nicht zu lesen als einen Roman, der sich der Furcht der Wende annimmt und praktisch das Gesellschaftliche in diese Krankengeschichte transponiert – da kann ich nur den Kopf schütteln. Das wäre mir nie eingefallen, und ich glaube, da gibt es auch nichts Untergründiges, was ich nicht benennen könnte. Es hat einfach nichts miteinander zu tun.
Verdofsky: Muss man für die Prosa mehr wissen? Vorgefundene Zusammenhänge, die zu einer Geschichte gehören, lassen sich gestalten, auch ins Surreale heben, aber der Zusammenhang kann nicht einfach aufgelöst werden. Das braucht eine Form, selbst das Surreale mündet in einem kleinen in sich schlüssigen Erzählsystem. Das Gedicht braucht das nicht, es bleibt offen gegenüber Zusammenhängen?
Schmidt: Man muss es nicht, aber wenn ein kleines in sich geschlossenes System drin ist, dann finde ich das auch gar nicht schlecht. Das Gedicht „milde kleine diagnosesplitter“ ist für mich beispielsweise ein kleines abgeschlossenes System, in dem erst einmal nicht viel offen bleibt. An das man nicht unbedingt rangehen kann, Wörter rausziehen und sagen, das Gedicht könnte jetzt hier erweitert werden. Das ist für mich ein abgeschlossenes kleines Stück, von dem ich auch sagen würde, es wird eine Geschichte darin erzählt. Sowas gibt’s ja auch.
Verdofsky: Eine Geschichte kann sich gegen das Erzählen wehren, weil der Gegenstand zu groß ist, der Stoff zu sperrig oder auch nur, weil der Erzähler die Ungereimtheiten des Lebens nicht akzeptiert und sie runden will. Das Gedicht hat andere Möglichkeiten, es kann einfach eröffnen, ohne alle Voraussetzungen begründen zu müssen. Im Gedicht „siebter block; fünfter stock“ heißt es: „meiner mutter greinendes beispiel / lässt sich nicht blicken.“ Bezogen auf Königsberg genügt das, um einen biographischen Bruch zu erklären: Flucht, verlorene Beziehungen zu einer Stadt mit allen Folgen. Was der Erzähler ohne abgearbeitete Vorgeschichte so nicht setzen könnte.
Schmidt: Das Königsberg-Gedicht halte ich nicht für eines meiner typischen Gedichte. Das war wieder so ein Fall, wo ich eigentlich eine Geschichte schreiben wollte, habe dann aber keinen Zugang gefunden und fühlte mich mit meinen zwei, drei Königsberg-Besuchen auch nicht richtig gerüstet dafür. Ich hatte das Königsberg-Thema auch schon in einem Bobrowski-Essay abgehandelt und der steht für mich eigentlich soweit, dass ich gesagt habe, nein, Prosa machst du nicht nochmal darüber. Aber da war diese Verbindung der beiden Straßennamen: Ich habe an jener Stelle gestanden, wo meine Mutter als Kind gewohnt hat, und gesehen, was heute daraus geworden ist.
Die Straßenbahnschienen lagen noch da, ansonsten war es eine grüne Wiese, auf der linker Hand eine Reihe großer Wohnscheiben stand. Ich wollte sie irgendwie übereinbringen, diese beiden Straßennamen. Das war für mich das Entscheidende und auch der Anlass, das Gedicht zu schreiben. Ich weiß noch genau, wie ich danach gesucht habe. Es ist wirklich kein typisches Gedicht, es geht eben nicht um die Momentaufnahme. Ich habe eine Umschreibung dafür gesucht, dass ich in der Stadt war und meine Mutter nicht. Meine Mutter hat aber als Kind dort gelebt, und so bin ich auf diesen ersten Satz gekommen. Für mich ist es im Abbild eine Zwischenform zwischen einer Erzählung und dem, was ich unter einem guten Gedicht verstehe. Ich kann es nicht anders sagen.
SIEBTER BLOCK, FÜNFTER STOCK
lizentgrabenstraße, königsberg
uliza mariupolskaja, kaliningrad
das grünkommando plant längst attentate, es ist april.
durch meinen seitlichen leichtsinn streift pregelfarben
der wolf, seine pfoten hinterlassen wie zoten
im hirnschlick zeichen, dass nichts aus
noch vorbei ist. du bist mein hotel, wenn ich stammle:
leninskij steindamm. moskovskij unterlaak.
gealterte tatsachen, zu mosernden schlaufen gedreht
im modernden windgeruch. da ist schlecht anstalten
machen, heilanstalten zumal. ich trotze bei tisch.
motze bei freunden. beherzte witze, ins windspiel
gedrückt. auf schienen läuft sich der wolf
seinen wolf, sie liegen rostend im gras, dem man
den schlachtplan immer noch ansieht, aus dem
es trieb. wer da einst straßenbahn fuhr, lebt hier
nicht mehr, meiner mutter greinendes beispiel
lässt sich nicht blicken. in den plattengelenken
der wohnscheiben knirschen noch ziegel, zermürbte
kellergeschosse falten sehr sanfte bögen
neben das gleis. siebter block, fünfter stock –
das heutige haus schlägt drei fensterkreuze
unter den tauben himmel, die wimmernden angeln
kann er nicht hören. wenn ich auch weiß, wer ich bin,
geb ich acht. das grünkommando steht gewehr bei fuß.
Verdofsky: Wie verschieden muss man das Autobiographische in Prosa und Lyrik halten?
Schmidt: Bei der Lyrik habe ich immer das Gefühl, mich richtig nackig zu machen. Ich ziehe mich geradezu aus, wenn ich Lyrik schreibe und spare nichts aus, was an Widrigkeiten, aber auch an schönen Dingen in meiner Seele sich befindet oder wo auch immer. Bei der Prosa hingegen, zum Beispiel bei Du stirbst nicht, musste ich einen gewissen Punkt erreicht haben, an dem ich das Geschehen im Roman für mich zu einem guten Teil auch zur Abstraktion von der Wirklichkeit erklärt habe.
Es war ja nun mal die Crux, dass ich das begonnen hatte als Krankenbericht, dadurch war der Anfang gesetzt. Die ersten dreißig Seiten habe ich auch im Grunde nicht verändert. Ich habe zwar andere Namen und so etwas wie die dritte Person. benutzt. Dadurch sind meine Koordinaten ja aber nicht einfach verschwunden aus dem Buch! Dagegen anzuschreiben, machte schließlich die große Spannung aus. Und weil ich das geschafft habe, wurde es mir überhaupt möglich, das Buch loszulassen. Als ich in dem Buch nicht mehr das Ich war, konnte ich es weggeben.
Beim Gedicht verspüre ich das anders. Vielleicht ist es so, dass im Gedicht Seelenzustände benannt werden, die nicht konkret an autobiographischen Ereignissen festzumachen sind. Das sind archaische Dinge und etwas, das sich möglicherweise verallgemeinern lässt für verschiedene Leute. Bei dem ich nicht das Gefühl habe, dass ich damit etwas von mir preisgebe, was keinen anderen Menschen etwas angeht, sondern ich gebe eigentlich das preis, wovon ich denke, dass es auch andere Leute interessieren könnte. Dadurch, dass es nicht unmittelbar an biographische Fakten gekoppelt ist, entsteht auch kein schlechtes Gefühl.
***
Verdofsky: Sie haben früh begonnen: 1982 ein Heft in der Lyrikreihe Poesiealbum, 1987 Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik – ein wunderbarer Titel. Da zeigen Sie sich als Lyrikerin nicht am Anfang, sondern Sie sind mitten drin und dann kommt das Leipziger Literaturinstitut. War das als Handwerkschmiede unabdingbar oder eher ein Glied in der Kette, eine freie Autorenexistenz zu begründen?
Schmidt: Wenn man es so verstehen will, dann war es absolut das Zweite, aber ich war, das ist ein Irrtum, der auf meiner Biographie liegt, keine Studentin des Literaturinstituts. Ich habe einen sogenannten Sonderkurs besucht. In einem Sonderkurs hatte man eine Woche im Monat Anwesenheitspflicht in Leipzig. Während dieser einen Woche hörte man Vorlesungen zur sozialistischen Landwirtschaft, zur Mikrobiologie, zur sozialistischen Jugendforschung oder was weiß ich. Wir hatten da nichts Literarisches bis auf eine hervorragende Vorlesung von Ralf Schröder zur Sowjetliteratur, die war wirklich sehr, sehr gut. Aber ansonsten hörten wir da nichts Literarisches, wir verstanden das auch alle nicht als Schreib-Lern-Institut für uns, weil man an diesen Sonderkurs erst kam, wenn man ein Buch veröffentlicht hatte.
Ich habe den Sonderkurs 1986/87 gemacht, noch vor dem Band Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik, Ich war sehr froh, dass dieses kleine Bändchen Poesiealbum dafür ausgereicht hatte, denn ich war 1985 mit meinem Mann von Rüdersdorf nach Berlin gezogen und hatte in Berlin keine Arbeit gefunden. Aus diesem Grund habe ich mich in Leipzig beworben, weil es 500 Mark Stipendium gab im Monat. Diese eine Woche haben wir irgendwie hingekriegt mit drei kleinen Kindern. Es war so richtig aus der Not geboren, und ich begreife mich in diesem Sinne keinesfalls als Absolventin des Literaturinstituts.
Seminare gab es nicht, nur einmal einen Anflug desselben bei Max Walter Schulz zur Prosa. Wir haben tatsächlich nichts gelernt, was das Schreiben angeht. Aber die Vorlesungen, das muss ich sagen, waren nicht uninteressant. Wir hörten DDR-Koryphäen, die es ja durchaus gab, und es waren kritische Töne. Auch Ralf Schröder ist ja nicht von der Hand zu weisen, er hatte damals die Wende vorausgesagt. Er sagte, entweder es klappt jetzt mit dem Gorbatschow oder es ist zu Ende. Sowas hatte ich ja überhaupt noch nicht gehört, wir haben ihn verehrt, den Ralf Schröder…
Verdofsky: So hat das Leipziger Literaturinstitut für Ihr Schreiben letztlich keine Bedeutung?
Schmidt: Nicht im Sinne von Handwerk. Aber ich habe in Leipzig öfter mal Lesungen in der Steinstraße besucht und auf diese Weise zum Beispiel Adolf Endler und seine Frau kennengelernt, insofern war Leipzig schon nicht unwichtig für mich.
Verdofsky: Adolf Endler ist von der „Hauptstraße des sozialistischen Realismus“ abgewichen. Sie haben den „realistischen Sektor“ auch früh verlassen.
Schmidt: Naja, wenn ich so etwas überhaupt gemerkt habe. Ich hatte gerade dieser Tage Kontakt zu meiner ehemaligen Schule. Dort soll mir als wichtiger Persönlichkeit, die aus ihr hervorging, eine Vitrine im Schulmuseum gewidmet werden. Ich sollte nun einiges hinschicken und habe unter anderem noch das Heft gefunden, das vervielfältigt ausgegeben worden war an die Schüler der Schule mit meinen Gedichten aus der 10. Klasse. Ich fand es verrückt, als mir das in die Hände fiel. Und ich muss schon sagen, da bin ich doch wohl eher noch sehr auf dem realistischen Wege. Aber es finden sich durchaus ernst zu nehmende Stellen, über die ich heute staune. Diese Gedichte führten ja auch dazu, dass ich dann zu den Poetenseminaren der FDJ eingeladen wurde. Dort war der „realistische Sektor“ im Grunde dann sofort verlassen. Ich wurde schon in meinem ersten Seminar ermahnt, nicht bei Sarah Kirsch abzuschreiben, dabei kannte ich Sarah Kirsch damals überhaupt noch nicht.
Verdofsky: Das war aber negativ gemeint? Als Abweichung?
Schmidt: Nein, das war nicht negativ gemeint. In den Seminaren selbst war das nicht so. Man darf es sich nicht so vorstellen, dass da nun alles linientreu ablief. Das Nichtrealistische war, als ich ernsthaft zu schreiben begann, das Ursprünglichere, so dass ich mich auch mit der Prosa erst nach und nach in realistischere Bahnen begab, sonst wäre das vielleicht was ganz anderes geworden.
Verdofsky: Braucht man denn in der Prosa „realistischere Bahnen“? Ich habe den Eindruck, dass einiges aus Blinde Bienen und Finito fein surrealistisch korrespondiert.
Schmidt: Bewusst ist mir das nicht, es könnte aber sein, weil ich jetzt längst nicht mehr so streng wie früher zwischen lyrischen und prosaischen Schaffensphasen trennen muss. Das funktioniert nun auch in rascher Folge wechselnd. Ich mache einen Tag das eine, den anderen Tag das andere. Wie es sein wird, wenn ich wieder eine längere Prosa schreibe, weiß ich nicht. Ich habe vor anderthalb Jahren einen neuen Roman angefangen, zu dem ich zur Zeit überhaupt nicht komme, wegen lauter kleinerer Geschichten. Aber Erzählungen und Gedichte lassen sich sehr gut vereinbaren. Man verabschiedet sich ja nicht vorsätzlich von einem Tag zum nächsten aus einem bestimmten Ton oder aus einer Schwingung. Es kann sein, dass es da Übergänge gibt.
Verdofsky: Bei früheren Arbeiten hatte ich eher den Eindruck, dass das getrennt bleibt. Da gibt es Phasen, in denen viel Lyrik entsteht und dann Erzählstrecken, Zeiten des Ausprobierens. Das gilt auch für Ihre vier Romane: Ein Erfolg, eine Wirkung wird nicht einfach weitergetragen. Immer wieder ein neuer Ansatz, eine neue Eroberung der Geschichte, die zu erzählen ist. In den letzten Jahren, um das mit Blinde Bienen und Finito vielleicht einzugrenzen, sehe ich einen steten Wechsel, aber das heißt doch letztendlich, man muss mit getrennten Händen schreiben, damit sich die Bilder nicht in die Quere kommen. Und das ist gelungen.
Schmidt: Ich schreibe ja sowieso nur noch mit der Linken, schreibe nur noch einhändig, vielleicht liegt es daran (lacht). Es ist so, dass ich viele dieser Erzählungen nicht auf den Band Finito hin geschrieben habe. Wenn ich nochmal einen Band mit Kurzprosa veröffentliche, dann möchte ich ihn vielleicht auch thematisch ordnen. Wie das aussehen soll, weiß ich jetzt noch nicht, aber das werden dann sicherlich Geschichten, die sich irgendwo an den Händen fassen. Das tun die Geschichten in Finito nun nicht gerade. Aber ich muss auch sagen, dass sie entstanden sind auf innerlich gesetzte Anforderungen. Wenn irgendwo ein Wettbewerb ausgeschrieben war, da wollte Kathrin üben, ob sie das vielleicht kann. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt, Geschichten geschrieben für diverse Ausschreibungen und mich daran abgearbeitet. Das sind natürlich nicht die Geschichten, die vor dem Aneurysma lagen, sondern die, die danach kamen. Oftmals einfache Übungen, um überhaupt wieder etwas sagen zu können.
Verdofsky: Aber sie sind als Übungen nicht zu erkennen, sie sind hochliterarisch. Welche Geschichte vor dem Aneurysma lag und welche danach, bleibt verborgen. Die Geschichten in Finito haben zwar keine unmittelbaren thematischen Berührungen, aber sie sind schon miteinander verbunden durch Weitsicht und Weltempfinden, aber auch in Härte und Unerbittlichkeit. Beschwichtigungen lassen sich nicht erkennen.
Schmidt: Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir möglicherweise damit zu tun hat, dass ich diese Radikalität und Unerbittlichkeit im Alltag nicht zeigen kann oder will. Es funktioniert einfach nicht. Ich fühle mich hinterher wohl, wenn ich solch eine Geschichte geschrieben habe, und wenn sie auch noch so hart ist, sage ich mir, Mensch, jetzt hast du doch tatsächlich etwas bewältigt, was du real nicht aufarbeiten konntest, was dir nicht gelungen ist. Richtig befreit fühle ich mich dann und kann wieder in den Alltag einsteigen. Solch eine Funktion hat das möglicherweise auch noch, weil ich mir bestimmte Radikalitäten im Leben einfach nicht erlaube.
***
Verdofsky: Zurück zum Gedicht. Charles Olson meint: „lm Gedicht muss etwas stattfinden.“ Wulf Kirsten sagt es etwas ausholender: „Wenn das Gedicht von einem Spannungsbogen getragen wird, muss ein Kraftvektor durchgehen, der auf den starken Schluss gerichtet ist.“ Denken Sie ähnlich über die Wirkung eines Gedichtes?
Schmidt: Das stimmt für mich irgendwo schon. Aber was die Wirkung betrifft, gilt das, was Olson sagt, für mich noch eher als das, was Wulf Kirsten meint, weil im Gedicht ja tatsächlich immer etwas stattfindet. Auch wenn es nur die Weitergabe des Staffelstabes von einem Wort zum nächsten ist. Oder ein kleiner Blick, der sich von mir aus gesehen ganz anders darstellt, als wenn ein anderer auf dieselbe Sache drauf schaut. In diesem Sinne meine ich das. Es sind ja oft nur minimale Dinge, die in einem Gedicht passieren, aber sie passieren. Mit dem kraftvollen Schluss, das weiß ich nicht so genau.
Es gibt ja auch Gedichte, die ganz leicht und flappend sind. Ob man das nun als Kraftschluss oder Vektor bezeichnen kann, was durch sie hindurchgeht, ist mir nicht klar. Möglicherweise spielt da auch die Zeit eine gewisse Rolle. Wenn die Zeit noch hinzukommt, dann ertappt man sich ja oftmals dabei, dass solche kleinen, leisen, flappenden Gedichte viel nachhaltiger sind, als solche die auf einen starken Impuls schließen lassen.
Verdofsky: Ein Gedicht ist mehr, als einen Text auf den Punkt bringen. Das Gedicht braucht auch das Offene.
Schmidt: Ja, deshalb habe ich ja vorhin „milde kleine diagnosesplitter“ angeführt, das für mich ein in sich abgeschlossenes Gebilde ist, das mir auch sofort einfällt, wenn Sie jetzt auf das Offene im Gedicht zu sprechen kommen. Ein Gedicht ist allein schon offen, indem Wörter verwendet werden, die es vielleicht noch nicht gibt. Durch Neologismen ist das Gedicht ja etwas, was zur Seite der Bedeutung des Wortes hin offen ist. Ich sehe Wörter immer als Blasen in meinem Kopf, richtige runde Blasen, die einander schneiden, Schnittmengen bilden, in denen zum Beispiel Wortverbindungen entstehen. Wenn man durch diese Blasen hindurchgeht, gerät man in ganz neue Wortsphären.
Die Blasen sind perlenähnlich auf einer langen Leine, einem Strick aufgereiht, und für das Schreiben eines Gedichts nehme ich einen Punkt auf der Leine heraus, verknüpfe ihn mit knappen Punkten von anderen Stellen der Leine. Das entstehende Gewirr ist dem der Blasen nicht unähnlich, aber weniger großräumig, die Bedeutungshöfe sind genauer herausgearbeitet als beim zufälligen Betreten der Blasen. Danach gibt es noch einen und noch einen und manchmal berühren sich die Elemente auch untereinander wieder und es entsteht ein großes Gewirr, wie eben mit diesen Blasen. Das lasse ich einfach immer wirken in mir.
Verdofsky: Verschiedene „Bedeutungshöfe“ berühren sich und dazwischen liegt ein Moment neuer Wahrnehmung? Ein Moment zwischen Bewegung und Standpunkt?
Schmidt: Meine Vorstellung vom Gedicht ist immer die einer Berührungsfläche. Was sich da berührt, weiß ich nicht, es sind nur zwei gegensätzliche Elemente, die in kleinen Momenten aneinander haken und daraus entsteht dann irgendetwas, was das Gedicht wert macht, aufgehoben zu werden. Wenn ich aber jetzt wieder sage, es handelt sich um die Realität in meinem Kopf, dann stimmt es eigentlich nicht. Ich weiß nicht genau, was das für Flächen sind. Es sind einfach zwei unterschiedliche Wahrnehmungsebenen oder zwei verschiedene Bedeutungen von ein und derselben Sache. Es kommt einfach auf die Berührung, Verzahnung in ganz kleinen Zusammenhängen an. Und in diesem Sinne ist es tatsächlich der eigentlich unhaltbare Moment zwischen Schritt und Standpunkt.
Verdofsky: Gibt es dafür ein besonderes Beispiel?
Schmidt: Mein Gedicht „reloaded“ würde ich als Beispiel für das Berühren von zwei sehr unterschiedlichen Ebenen, und zwar auch bis ins Bild hinein, ansehen. Himmel und Erde, Frost und Hitze, Liebe und Nichtmehrliebe, Peristaltik und Stillstand – alles bildet sich im Konglomerat in dem Text ab.
RELOADED
sporadische spuren von faulem in der zeitbeuge,
dazwischen die eine oder andere herzvariante,
der das fühlmittel fehlt, während die lunge
den füllstandsanzeiger blockiert.
die fingerknospen auf suche im zungenbecken,
hier und da blütenansätze, -körbe. vestibuläre
räume, in denen es ordnungen schneit. kann sein,
dass wir den elbdeich verwechselten und eine
peristaltische manschette vor augen hatten, jedenfalls
wurde dem wasser die luft abgeschnürt.
von himmelsfetzen gänzlich bedeckt, lagerten wir
in imaginärer tundra. kann sein, dass es das war,
was permafrost auslöste. was dir den eisschweiß
auf die stirn trieb.
Verdofsky: Wenn zwei völlig verschiedene Dinge aufeinander stoßen, die nicht zueinander passen, zeigt sich Bretons Ästhetik des Paradoxen. Adolf Endler hat das in dem Interview-Band Dies Sirren beschrieben: Zwei Gegenstände treffen aufeinander, die gar nichts miteinander zu tun haben, aber aufgrund dieses Zusammenstoßes entsteht ein Funke. So etwas sehe ich bei Ihnen auch, sowohl in den Erzählungen als auch in den Gedichten, dass Dinge, die so gar nicht zusammenpassen und auch formal getrennt sind, aufeinander stoßen. Ob nun Funken sprühen, ich würde eher sagen, inverse Motive flattern auf wie Fledermäuse. Ist das ein bewusster Gestaltungsvorgang?
Schmidt: Ich habe tatsächlich nach dem Platzen des Aneurysmas so etwas durchgespielt, dass ich Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, nebeneinander geschrieben und versucht habe, irgendetwas zu sehen dabei. Es gibt da auch den einen oder anderen Erfolgszweig, keinen richtigen Ast, aber vielleicht doch einen Zweig. Das war zu jener Zeit, da ich wieder reinkommen wollte ins Schreiben von Gedichten. Nach dieser Erfahrung kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sowas auch sucht, weil es eben unter Umständen funktionieren kann.
Mir fällt ein Gedicht ein, aber kein besonders gutes: dieses Gespiegeltsein an der Lebensachse in dem Gedicht „ob sommer, ob winter“. Das ist auf diese Weise entstanden. Es waren nicht Sommer und Winter, die da aufeinander prallten, es war die Idee, dass ich auf einen bestimmten Punkt im Leben zugegangen bin, an der Lebensachse spiegelt sich das alles und endet jetzt in entgegengesetzter Richtung auf genau dieselbe Weise, wie es angefangen hat.
Das war so ein bewusst herbeigeführtes Motiv.
Verdofsky: Man merkt es dem Gedicht nicht an. Das hat auch eine gerade Linie: „… die tochter / spielt mutter, die mutter gibt ihren abschied.“ Es folgt die Drehung, „so trag ich mich selbst dorthin, wo die / irrende zeit zwischen roh entrindeten / stimmen noch immer ihr ende sucht“. Dann kommt das harte Bild, „das schwarz steht und schweigt, / und aus dem spiegel steigt / der erste schrei.“
OB SOMMER, OB WINTER:
allmählich nehmen die tage
sich kürzer aus. sie schrumpfen
zwischen den fingern, flitschen
in kleine spalten zwischen den stunden
und halten erschöpft ein, wenn auch
ich innehalte. sie zählen
vierundzwanzig stunden, deren jede
so lang ist wie vordem, doch einzeln
gemessen. zusammengenommen, geraten
sie schneller denn je an ein ende.
mich wundert das schon,
bis ich allmählich merke: nicht originale,
sondern kopien halten mich hin! am tage
der lebensmitte gespiegelt, geben sie
bilder von früheren tagen zur prüfung,
an mir ist es nun zu vergleichen:
heute hat morgen schon einmal
stattgefunden als gestern, zwar wechseln
menschen und orte, doch bleiben
die grundzüge gleich, die tochter
spielt mutter, die mutter gibt ihren abschied.
so trag ich mich selbst dorthin, wo die
irrende zeit zwischen roh entrindeten
stimmen noch immer ihr ende sucht,
das schwarz steht und schweigt,
und aus dem spiegel steigt
der erste schrei.
Schmidt: Aber es ist auf diese Weise entstanden. Ich rede nur von den inneren Abbildern der Gedichte bei mir selbst, die ja mit jeder Entstehung auch zu tun haben. Das ist ähnlich auch bei diesem Königsberg-Gedicht, was in meiner inneren Skala auch nicht sehr weit oben steht, eben durch die Art der Verfertigung. Weil das nicht von selbst gekommen ist, sondern ich etwas gesucht habe. Das hat für mich einen anderen Stellenwert. Zum Beispiel bei „blinde bienen“ kann ich mich genau erinnern, dass jede Zeile da war, dann entstand das Gedicht. Es stimmte und es stand. Da hatte ich auch ein gutes Gefühl. Das ist ein anderes Gefühl als bei diesen beiden Gedichten, an denen ich auch hinterher noch sehr lange gewerkelt habe, während „blinde bienen“ sehr schnell entstanden ist.
Verdofsky: Es gibt in Ihren Gedichten einen Widerstreit zwischen Anmut – die kommt meist aus der Natur – und der Vernunft. Ich sehe in dem Gedicht „frühlings aufstieg“ mit dem Wal, den die Vögel hoch an den Himmel werfen, einen gewissen Übermut für die Bildsprache, wie ein Maler, wie ein Chagall das eben auch machen würde. Hier kann die Vernunft nicht fragen, wie soll das gehen?
Schmidt: Haben Sie noch ein anderes Beispiel?
Verdofsky: In dem Gedicht „blinde bienen“ herrscht das Bild vor aller Kausalität: „… wenn die bienen in ihrer blindheit / am himmel baumeln wie faules gezänk…“
Schmidt: Das war die Ursprungswendung zu diesem Gedicht, „am himmel baumeln wie faules gezänk“, das war das erste, was mir dafür eingefallen ist, als ich damit begonnen habe.
Verdofsky: Das meinte ich, ein Bild das kommt, ist nicht gleich zu erklären, dann steht das so, auch wenn es mit „faulem gezänk“ gleich woanders hingeht. Man liest das Gedicht, da kann noch so viel „Gewirr“ drum herum sein, und kehrt immer wieder zu diesem Bild zurück. Es zeigt sich eine Aura und keine schiefe Metapher.
Schmidt: Aber wie mir das eingefallen ist, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, es war eine klangliche Abfolge. Ich habe erst: „blinde Bienen“ gedacht. „Am Himmel Bienen, Himmel, Himmel baumeln, baumeln, faulen“, dann kam noch das „Gezänk“, und fertig war die Zeile. Ich fand sie gleich auch ziemlich stark, muss ich sagen, und habe sie dann zur Grundlage dieses Gedichts gemacht.
Verdofsky: So kann man in einem Gedicht sich das leisten, was die Leute in realistischer Befangenheit nicht sehen mögen, Bilder, die sich der Vernunft nicht beugen, die nicht real erklärbar sind.
Schmidt: Na, schauen wir uns diese Zeile doch mal an: „wenn die bienen in ihrer blindheit / am himmel baumeln wie faules gezänk“. Es geht um das Ansprechen verschiedener Wahrnehmungsebenen, des Visuellen, des Auditiven, des Olfaktorischen sogar, durch das Wort „faul“. Bestenfalls könnte es sein, dass sich der Leser des Gedichtes durch die in dieser Zeile angelegte Synästhesie irritiert fühlt, sie nicht sogleich auseinandernehmen kann, weil er sie nicht erwartet hat und ihr nun auf die Spur zu kommen versucht. Das Gedicht hätte ihn dann gewissermaßen gefangen genommen.
Inhaltlich jedoch, wenn man das überhaupt so sagen mag, geht es im Text um das Altern, was ich beim Schreiben jener ersten Zeile aber überhaupt noch nicht wusste. Dieses Nachdenken über das Alter und das Altern, kann man ja durchaus auch als Vernunft begreifen. Insofern ist das Schreiben der ersten Zeile der erste Schritt, den ich dann gewissermaßen „vernünftig“ auffülle, ausfülle, ausmale.
Verdofsky: Im Gedicht ist das poetische Ich allgegenwärtig. Aber Natur und Landschaft, die Bilder, die man aus ihnen bezieht, sind überall anders. Wobei nichts so sein muss, wie es scheint, denn Natur widerstrebt ja eigentlich der Nachahmung. Auf der einen Seite das Ich, das aus seiner Bezüglichkeit nicht heraus kann, auf der anderen Seite die Bilder, die man sich borgt, die sich verändern können, wenn man auch die Wahl hat, welches Bild man wählt. Beim Ich hat man das ja nicht.
Schmidt: Die Grundvoraussetzung ist, dass ich mich tatsächlich im Moment des Schreibens als ungebunden empfinde und insofern auch nach jeder Seite offen. Das ist so ein besonderer Zustand, den ich für die Prosa nicht unbedingt brauche. Deswegen lese ich auch, bevor ich mich ans Gedicht setze, Gedichte von anderen. Ich bringe mich in die Situation, mir überhaupt wieder zu vergegenwärtigen, was ein Gedicht ist, was ein Gedicht kann. Ich gerate dann in einen solchen, sage ich nun Seelen- oder Geisteszustand, jedenfalls in solch einen Zustand, dass ich fühle, ich kann jetzt irgendwoher etwas Eigenes nehmen.
Ich verorte mich dann auch in einer sehr konkreten Situation, beispielsweise während einer Autofahrt oder einem Bad in einem See. Das war zum Beispiel bei diesen „Wasser-Gedichten“ so, da hab ich mich auf einer Autofahrt in der Nähe von Jena gesehen. Das Gedicht hat damit gar nichts zu tun, aber ich selbst war bei Jena mit dem Auto unterwegs. Fuhr nur vorbei, nicht hinein. Jena war eine wichtige Stadt für mich, ich habe dort studiert. Und das Gedicht, das unbedingt einen Bezug zum Wasser haben sollte, habe ich während dieser Autofahrt an Jena vorbei aufgelesen. Das kann man nur, wenn man in dem Sinne ungebunden, aber gleichzeitig auch verhakt ist mit einem konkret erlebten Stück Natur.
***
Verdofsky: Die besondere Situation für Lyrik, wie Ruhe, abgeschlossene Zeit, brauchen Sie nicht? Ein kleiner Impuls genügt?
Schmidt: Früher stand mein Schreibtisch ja ohnehin im Esszimmer der Familie, ich hatte kein Arbeitszimmer, bis wir hier das Haus bezogen. Ich habe an der Gunnar-Lennefsen-Expedition mit meinen Kindern im Wirbel drum herum geschrieben. Ich hatte ja damals noch einen ganz kleinen Sohn, ein Baby, den habe ich zwischendurch gestillt und dann wieder auf den Balkon gestellt. Ruhe und Abgeschlossenheit brauchte ich wirklich nicht, aber das hat sich mit den Jahren auch geändert. Das möchte ich nicht auf das Aneurysma schieben, das ist einfach eine Frage des Alters.
Heute habe ich es schon gern, wenn die Tür zu ist und ich dann meine Arbeit machen kann. Andererseits kann ich auch überall arbeiten. Es ist nicht so, dass ich ein bestimmtes Ambiente brauche oder eine Aura. Ich brauche auch keinen Blick aus dem Fenster. Marcel Beyer hat sich seinen Schreibtisch in Rom so hingestellt, dass er auf die Terrasse schauen konnte. Wäre mir nie in den Sinn gekommen. Während ich wirklich schreibe, sehe ich überhaupt nichts. Dann sitze ich nur vor meinem Bildschirm, habe auch kein Gefühl dafür, was um mich herum los ist, sondern bin dann richtig drin und mache das. Aber auch sympathisch, dass es bei allen anders funktioniert.
Verdofsky: Eine große Familie, die Tagespflichten, die einfach zwingend sind und trotzdem soll was entstehen. Braucht es nicht auch mal eine Unterbrechung, einen Umbruch, damit Anregungen zufliegen?
Schmidt: Ich habe das, was ich geschrieben habe, immer aus sehr konkreten, auch autobiographischen Anlässen herausgezogen oder aus einem geometrischen Modell. Für Koenigs Kinder, das halte ich übrigens für mein bestes Buch, hatte ich so ein geometrisches Modell vor Augen: Ein Dreieck, drei Linien, die aus den Eckpunkten kommen, aufeinander zulaufen, sich in einem Punkt treffen und wieder im Unendlichen verlieren, ohne erneut ein konkretes Dreieck zu fixieren. Aus dieser Grundkonstellation heraus wollte ich von Anfang an erzählen.
Auf den ersten Seiten werden, wie die drei Eckpunkte des Dreiecks, die drei handelnden „Hauptparteien“ eingeführt, die so gar nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Aber der Grund, den Roman zu schreiben, ist wieder stark autobiographisch gefärbt. Mein Vater wurde 1946 von den Russen zu 25 Jahre Haft verurteilt und hat davon auch tatsächlich 10 Jahre abgesessen. Irgendwie hat das, seit ich es mit 17 Jahren erfuhr und darüber nicht reden durfte, so in mir gearbeitet, dass es Roman werden wollte.
Ich fühle, dass ich immer noch voller Geschichten bin. Vielleicht stellt sich das auch mit dem alltäglichen Leben her. Ich denke nicht an einen Umbruch oder „was Neues“. Ich habe genug zu erzählen, so dass gar kein Platz ist für das Gefühl, jetzt ausbrechen zu müssen. Wenn ich tatsächlich eine Ortsveränderung suchte, habe ich seit 2004 Stipendien angenommen, der Kinder wegen konnte ich das vorher nicht. Mit Wiepersdorf habe ich angefangen, das war erstmal nicht so weit weg, ich konnte bei Notwendigkeit am Wochenende nach Hause fahren. Dort war ein hervorragendes Arbeiten, so dass ich mich in den darauffolgenden Jahren, als ich durch das Aneurysma auch ein bisschen aus dem Geschäft raus war – ich hatte nicht viel Geld und musste ja irgendwie sehen, wie wir über die Runden kommen – mich um Stipendien beworben und einige auch bekommen. Ich konnte dort stets hervorragend arbeiten, egal unter welchen Umständen. Es ist einfach nur, dass ich weiß, ich habe nichts anderes zu tun, keine anderen Pflichten, dann kann ich arbeiten, wie ich möchte.
Verdofsky: Wenn das Anregende Ihnen so zufliegt, wie bewahren Sie es?
Schmidt: Mein Schwiegervater schreibt auch und wundert sich immer, dass ich nicht mit einem Diktiergerät rumlaufe, mir niemals Notizen mache. Aber das tue ich tatsächlich nicht. Noch nie, selbst wenn mir dadurch vielleicht auch manches Gedicht schon durch die berühmten Lappen gegangen ist. Manchmal fällt mir etwas ein und ich schreibe es natürlich nicht sofort auf, dann merke ich nach einiger Zeit, dass es weg ist. Aber es ist auch genug anderes da, was ich verwenden kann. Ich erlebe das bei Kollegen oft anders, aber bei mir ist das irgendwie noch nicht am Ende. Einen Stoff suchen, das habe ich noch niemals gemacht.
Verdofsky: Ich kann bei Ihnen auch keine literarischen Leitbilder, keine Prägung erkennen. Aber literarische Anreger wird es geben?
Schmidt: Ich gehe ganz absichtslos an mein Buchregal, nehme das, was mir ins Auge sticht. Letztens, als ich anfing diese „Wasser-Gedichte“ zu schreiben, da habe ich Marion Poschmann zur Hand genommen. Oder immer wieder lese ich sehr gern Elke Erb, ob das Sonanz ist oder Der Faden der Geduld, diese kleinen Prosaminiaturen. Das war das erste Buch von ihr, das ich überhaupt gelesen habe. Sofort war ich hellauf begeistert. Es war in der DDR erschienen, ich konnte überhaupt nicht fassen, dass es so etwas hier gab. Das erlebte ich als mir so verwandt, meiner Sicht und meiner Art. Ich hab mich dann auch nie mehr allein gefühlt, die Nähe zu Elke Erb immer wieder gesucht, sie aber im Persönlichen nie so richtig gefunden. Also liebe ich sie eben aus der Ferne und stricke ihr Socken.
Verdofsky: Ein Umgang mit Anregern wie ein Bewegen in der Natur? Bestimmt von Zufälligkeiten und Stimmungen?
Schmidt: Ja, soweit man beim Lyrik-Lesen von Zufälligkeiten sprechen kann, denn es ist ja nicht zufällig, was jemand liest. Wenn man selbst Lyrikerin ist, dann hat man natürlich eine Reihe Lyrik-Bände zu Hause stehen. Insofern geht das über eine gewisse Zufälligkeit schon hinaus, aber was man dann letztlich zur Hand nimmt, das folgt keinem Grundplan. Die erste Gedichtsammlung, die ich mir selbst gekauft hatte, da war ich vielleicht dreizehn Jahre alt oder zwölf, von meinem ersten Taschengeld für eine Mark, das war ein Reclam-Bändchen von Lundkvist. Ich war ja damals ganz klein, hatte keine Ahnung von Gedichten, aber empfand die als großartig. Wenn ich sie heute lese, empfinde ich es natürlich nicht mehr so, aber damals war ich schwer beeindruckt. Ich wollte unbedingt auch solche Gedichte schreiben wie Artur Lundkvist.
Verdofsky: Gab es frühen Einfluss durch Dritte?
Schmidt: Ich hatte eine Tante, eine sehr unangepasste Deutschlehrerin, die mir komischerweise anlässlich der Jugendweihe ihrer Zwillingstöchter 1974 Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura geschenkt hat und mir sehr ans Herz legte, das sei ein ganz hervorragendes Buch. Ich habe es auch sofort gelesen und nicht viel verstanden. Aber ich kam in einen Rauschzustand und habe das mit einer großen Begeisterung gelesen, mehrere Male. Das gab es schon, jemand kam und gab mir was. Ich hatte sonst in meiner Umgebung solche Ansprechpartner nicht. Meine Eltern hätten mir von sich aus kein Buch empfohlen.
Verdofsky: Vielleicht ist es richtiger, Entdeckungen selbst zu machen?
Schmidt: Ich fand das schon sehr gut, dass die Tante mich auf diese Bahn gebracht hat. Ich war sehr hungrig und hab sowas gesucht, aber ich hätte es bei mir zu Hause nicht gefunden. Meine Eltern haben zwar auch gelesen, aber die waren im „Buchclub 65“, bekamen jeden Monat ein Buch und haben dann den ganzen DDR-Kram von vorn bis hinten runter gelesen. Darüber wurde nie gesprochen bei uns, Literatur spielte überhaupt keine Rolle. Von mir aus war ich schon sehr begierig, was zu finden und aufzunehmen. Ich hatte auch gute Lehrer.
In der 11. Klasse hatten wir Geschichte bei einem, der in anderen Klassen auch Deutsch unterrichtete und wusste, dass ich Gedichte schrieb. In einer Pause hat er mir im Vorbeigehen, sehr unauffällig, einen Band Reiner Kunze zugesteckt, der ja damals ein offiziell verfemter Autor war. Später Jessenin, Blok, Braun, Kirsch, Kunert. Natürlich fühlt man sich als Schülerin durch solche Aufmerksamkeit auch geehrt, aber es war eine unabgesprochene Sache zwischen uns, das nicht publik werden zu lassen. Weitergereicht habe ich dennoch, das war in seinem Sinne.
***
Verdofsky: Sie haben jahrelang als Kinderpsychologin gearbeitet, wie ist das mit dem Verhältnis von Psychologie und Literatur? Gab es Überschneidungen oder Störungen? Oder hat das eine grundsätzlich mit dem anderen nichts zu tun?
Schmidt: Ich denke, solange ich nur Gedichte publiziert habe, spielte das eher keine Rolle. Das war einfach völlig voneinander unterschieden. Ich erinnere mich, wenn ich von Hellersdorf aus, wo wir damals wohnten, mit Bus und Straßenbahn zur Arbeit nach Marzahn fuhr, hatte ich meistens ein Gedicht fertig, als ich ankam. Das war auf der langen Fahrt entstanden, ich habe es abends aufgeschrieben und weggelegt. Während der Berufsarbeit als Psychologin hätte mich nichts zur Prosa gedrängt. Allein zeitlich wäre es eine Illusion gewesen, ich hatte neben der achtstündigen Arbeitszeit damals vier kleine Kinder zu versorgen.
Als ich dann 1990 mit der Psychologie aufhörte, traute ich mich noch lange nicht, freiberuflich zu arbeiten. Vielmehr hatte ich eine reguläre Stelle als Redakteurin der Berliner Frauenzeitschrift YPSILON inne, ehe ich mich für drei Jahre in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen begab. Erst 1994 wagte ich den Schritt in die freiberufliche Existenz, und sofort begann ich, am ersten Roman zu arbeiten.
Genügend Zeit lag zwischen der psychologischen und der schriftstellerischen Arbeit. Zeit, in der ich das, was ich als Psychologin erlebt hatte, weit wegdrängte, weil es die schriftstellerische Arbeit tatsächlich behindert hätte. Was ich erlebt hatte im Beruf, hätte sich wieder und wieder vorgedrängt, aber „verarbeiten“ hätte ich das nicht können – es wäre mir wie Verrat an meinen Patienten vorgekommen. Ich war keine schlechte Psychologin, aber ich glaube, dass das eine das andere nicht zugelassen hätte.
Verdofsky: Gab es nie die Versuchung, psychologisches Wissen für Figurenkonstellationen zu nutzen?
Schmidt: Das habe ich mir regelrecht verboten, es wäre für mich überhaupt nicht gegangen. Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Gebiete. Die sind beide wichtig und auch beide fruchtbringend, aber ich musste mich entscheiden, das eine oder das andere. Und die Literatur hat gesiegt. Wenn man zum Beispiel Psychoanalytiker ist und Fallgeschichten aufzuschreiben hat, ist das etwas völlig anderes, als Literatur zu machen. Ich habe sofort versucht, die psychologischen Kategorien aus dem Bewusstsein zu drängen. Aber natürlich hat man einen Blick auf Menschen und Gruppen, der durch ein solches Studium geprägt ist und bleibt, das stimmt natürlich. Ich hoffe, dass ich diesen Blick niemals problematisieren muss, sondern dass er unterschwellig bleibt.
Verdofsky: Die Wende von 1989 zeigt sich literarisch bei Ihnen nicht als Einschnitt?
Schmidt: Sozial und familiär war die Wende schon ein Einschnitt. Im Schreiben war es tatsächlich kein großer Einschnitt, weil ich eigentlich auch davor das Gefühl hatte, das zu machen, was ich möchte und was ich kann. Ich habe viel Glück gehabt, mehr Glück als viele Leute aus dem Prenzlauer Berg, weil ich wahrscheinlich zu naiv war, zu kompromisslerisch kann man gar nicht sagen. Ich habe lange Zeit tatsächlich geglaubt, das eine mit dem anderen in Berührung bringen zu können, die offizielle DDR-Schriftstellerverbands-Szene mit dem Prenzlauer Berg. Und damit war ich ja nicht allein. Ich erinnere mich an Johannes Jansen, Brigitte Struzyk oder auch Asteris Koutoulas, die in beiden Szenen zugange waren. Wir waren aber auch nicht unmutig, in meiner Stasi-Akte steht seit 1987, dass ich ein „feindliches negatives Element“ bin.
Verdofsky: War Ihnen das gar nicht bewusst?
Schmidt: Nee (lacht). Ich habe seit 1985 eine Freundin, die zum Kern der Opposition in der DDR gehörte. Sie hat im Friedrichsfelder Friedenskreis gearbeitet. Wir waren öfter mal zu Lesungen im Prenzlauer Berg, aber ich war erstens viel zu schüchtern und zweitens sah ich wahrscheinlich immer so aus, dass sich beim zweiten Treffen niemand mehr an mich erinnern konnte. Ich war immer unauffällig in irgendwelchen kleinen Eckchen verschwunden und habe auch nie jemanden angesprochen. Ich war einfach zu schüchtern und zu zurückhaltend. Und was die dort gelesen haben, war meistens nicht wirklich gut. Also habe ich mich gefreut, Elke Erb da zu sehn. Das war mein Erlebnis.
Meine Freundin hat dann gesagt, lies du doch auch mal deine Gedichte vor. Das war vielleicht 1985/86. Ich habe meine Gedichte geschnappt und bin zu Stephan Bickhardt gegangen, der das alles unter sich hatte. Der hat sie auch gelesen, gab sie mir irgendwann zurück und sagte, nee, das wäre nichts für sie. Da habe ich halt gedacht, naja, die Gedichte taugen nichts. Das war eigentlich verrückt, denn was dort gelesen wurde, stand qualitativ kein bisschen über meinen Gedichten, die 1987 in dem Band Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik erschienen und noch heute nachlesbar sind! Ein Freund hat mir das Jahre später erklären müssen: Sie dachten wohl einfach, ich sei geschickt worden, vom Verband oder von der Stasi. Ich hatte mich ja tatsächlich immer im Hintergrund gehalten. Aber das hatte mit meiner Schüchternheit zu tun und nicht mit einem eventuellen Auftrag.
Es war verdächtig, dass ich beim Poetenseminar gewesen war, dass ich schon 1982 das erste Bändchen hatte machen dürfen und der nächste Band in Arbeit war. Ich gehörte für sie nicht rein in ihre Szene, obwohl ich bei vielen Lesungen gewesen war, aber das hatte eben nie einer wahrgenommen. Auch wohnte ich nicht im Prenzlauer Berg, sondern immer schon in Hellersdorf. Ich stand abseits. Als dann mein zweites Buch erschien, im Verlag Neues Leben noch dazu, haben sie sich vielleicht bestätigt gefühlt. Ich war zu naiv, das alles zu durchschauen. Damals war ich als Provinzei nach Berlin gekommen, war nicht durchgängig opportunistisch, aber auch nicht das, was man heute als DDR-Feind bezeichnen würde.
Ich fühlte mich hingezogen zum Prenzlauer Berg, kam aber nicht rein. Meine Erziehung war durch die Haftzeit meines Vaters so auf Unauffälligkeit und Angepasstheit getrimmt, dass ich daran einfach noch lange zu tragen hatte.
Verdofsky: Gab es denn mit der ersten Buch-Veröffentlichung keine Reibereien? Der Verlag Neues Leben war ja besonders linientreu.
Schmidt: Ich hatte damals Dorothea Oehme als Lektorin und fand sie irgendwie ganz passabel für mich. Man war sich ja unter der Hand in der DDR ohnehin darüber einig, was man von den Oberen zu halten hatte, und so war das mit ihr auch kein Problem, alles zu besprechen. Sie hat gesagt, wir müssen sehen, dass wir das durchkriegen beim Verlag und den richtigen Gutachter finden. Als das Cheflektorat anstand, hatte der Cheflektor Lewerenz so ungefähr fünf Gedichte aus Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik ausgesucht, die seiner Meinung nach nicht gingen. Das war unter anderem ein gereimtes Gedicht über die Grenze und noch vier oder fünf andere. Der Cheflektor sagte, diese Gedichte könnten so nicht erscheinen, an den und den Stellen müsse geändert werden. Darauf Dorothea Oehme: Naja, wollten wir ja eigentlich nicht, wir werden mal sehen. Lewerenz hatte keine Notizen, nichts vorbereitet und daraus schloss die Lektorin, dass er einfach nur ad hoc agierte. Beim nächsten Mal hat sie ihm dann in meinem Beisein fünf andere Stellen als bearbeitet gezeigt, die er nicht beanstandet hatte. Der hat das nicht bemerkt. Und so ist das Buch unverändert durchgekommen, alles ist so geblieben, wie ich es geschrieben hatte.
Verdofsky: Das ist ja wie bei Brechts Schul-Anekdote mit den als Fehlern angestrichenen korrekten Stellen.
Schmidt: Ich habe darüber auch gestaunt, aber eigentlich erst hinterher. Ich hatte ja schon das Poesiealbum dort gemacht. Da war auch Dorothea Oehme meine Lektorin. Aber ich war auch sehr jung und kannte keine anderen Verhältnisse, das darf man nicht vergessen. Das war alles für mich ein Reinfinden und Reinfuchsen, ich kam aus der Provinz. Und alles war für mich erstmal sehr fremd, aber eigentlich auch schön, dass Leute meine Art zu schreiben, ernst nahmen.
Verdofsky: Wie war das dann mit dem westlichen Literaturbetrieb?
Schmidt: Nach ’89 habe ich mir wirklich selbst einen Maulkorb auferlegt und gesagt, wenn du schon in der DDR im Verlag Neues Leben ein Buch machen konntest, viele gute Leute – ich dachte an Papenfuß und andere – konnten das nicht, dann musst Du erst mal die Klappe halten. Aus der Wendezeit werden sich keine Gedichte von mir finden. Da findet sich vielleicht der eine oder andere Zeitungsartikel, aber kein Gedicht. Ich wollte das für mich aussitzen, dass ich in der DDR publizieren konnte und andere, die ich als meine Freunde betrachtete, hatten diese Möglichkeit nicht.
Verdofsky: Aber Sie haben weiter Gedichte geschrieben?
Schmidt: Ja, ich habe dann 1993 zum Leonce-und-Lena-Wettbewerb was eingeschickt, wenn man jung ist, denkt man natürlich, vier Jahre sind eine lange Zeit, keiner kennt dich. Im Westen kannte mich ja wirklich niemand. Da hat mich Christian Döring rausgefischt, der kannte mich natürlich auch nicht, aber dem waren meine Gedichte aufgefallen. Und als ich dann zum Leonce-und-Lena-Preis eingeladen wurde, war ich glücklich. Da hatte ich das Gefühl, jetzt hast du es irgendwie für dich geschafft. Kein schlechtes Gewissen mehr, die Verhältnisse waren ja auch etwas geklärter. Man bekam einen anderen Blick auf die Vergangenheit. Dass ich dann auch noch den Preis zugesprochen bekam, war das Tüpfelchen auf dem i, aber längst nicht so wichtig wie die Tatsache, dass ich jemandem aufgefallen war.
Verdofsky: Und darauf ließ sich dann alles aufbauen?
Schmidt: Ja. Dann hat mich Suhrkamp gefragt, ob ich ein Manuskript hätte. Das war wieder die Situation wie früher. In der DDR bin ich auch nie zu einem Verlag gegangen, macht mal irgendwas, sondern die sind zu mir gekommen. Das ging dann nach der Wende so weiter, ich fühle mich schon sehr privilegiert. Das kann ich erzählen, wem ich will, das hat kaum ein anderer Schriftsteller erlebt. Ich habe nie ein Manuskript einem Verlag angetragen. Darüber kann ich nur immer wieder staunen.
***
Das Gespräch wurde am 23. August 2011 in Berlin bei Gewitter und Sturzregen geführt.
die horen, Heft 244, 4. Quartal 2011
„Meine Gedichte sind nebenbei im Kopf gewachsen.“
– Gespräch mit Kathrin Schmidt. –
Carsten Gansel: Frau Schmidt, Sie gehören zu einer Generation, von der man unter Hinweis auf das Titelgedicht des ersten Lyrikbands von Uwe Kolbe sagen kann, dass Sie in die DDR „hineingeboren“ wurde. Wie Uwe Kolbe haben auch Sie zu Beginn der 1980er Jahre mit Lyrik debütiert. Welche Autoren waren für Sie als junge Autorin richtungweisend?
Kathrin Schmidt: Der erste Lyrik-Band, den ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe, war eine Reclam-Ausgabe mit Gedichten von Artur Lundkvist, einem Schweden. Ich war noch sehr jung, vielleicht zwölf Jahre alt. Die Lektüre hat damals sehr viel in mir ausgelöst, weil ich so eine Art zu schreiben nicht kannte. Die Texte unterschieden sich von dem, was wir im Schulunterricht durchnahmen. So habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ein Gedicht nicht unbedingt gereimt sein muss. Daraufhin habe ich weiter versucht, mir Bücher zu besorgen. Ich hatte einen sehr guten Deutschlehrer, der mir unter der Hand Bücher von Jewgeni Jewtuschenko, Sarah Kirsch und sogar von Reiner Kunze zugesteckt hat, was ja nun völlig untypisch war für einen DDR-Lehrer. Alle diese Bändchen waren zwar bei Reclam erschienen, man konnte sie aber nicht so ohne Weiteres kaufen. Russische Dichter haben wir insgesamt sehr stark rezipiert. Die wurden natürlich, soweit sie einigermaßen systemkonform waren, weitgehend übersetzt. Wichtig wurden etwas später dann auch die Gedichte von Hanns Cibulka für mich. Im Bereich der Prosa hatte ich mit 16 Jahren ein Leseerlebnis sondergleichen, das war Irmtraud Morgners Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura. Dieses Buch habe ich in einem Rauschzustand gelesen. Ich weiß nicht, ob ich so ein Erlebnis später nochmals hatte, auch wenn ich heute sicher bin, dass ich damals eigentlich nichts davon verstanden hatte. Ähnlich war es vielleicht nur noch mit Günter Grass’ Blechtrommel und Gabriel Garcia Marquez’ Hundert Jahre Einsamkeit. Es waren in der DDR eine Menge guter Bücher erhältlich und wenn man einen Buchhändler persönlich kannte, noch mehr. Anderes blieb schwer zugänglich. Für die Schriften von Sigmund Freud etwa brauchte ich später als Psychologiestudentin einen sogenannten „Giftschein“, den mir ein Professor ausstellen musste.
Gansel: Wann würden Sie denn Ihre ersten ernsthaften Schreibanfänge ansetzen? Ab wann hatten Sie die Ahnung, dass aus den Versuchen einer Adoleszenten womöglich mehr werden könnte oder schon geworden war?
Schmidt: Ich habe tatsächlich von Kindheit an geschrieben. Wohl sogar weniger gesprochen als geschrieben. Ich musste Klavierspielen lernen. Das habe ich eigentlich ganz gern gemacht. Allerdings war es während des Übens so, dass ich mechanisch die Finger über die Tastatur laufen ließ, während mein Gehirn Gedanken produzierte, die ich im Anschluss aufgeschrieben habe. Es waren schöne Stunden am Klavier, aber nur weil mein Kopf dabei spazieren ging. Das Schreiben gehörte so sehr zu mir, dass mir die Vorstellung, es als einen Broterwerb zu betreiben, den man sogar studieren konnte, zunächst gar nicht in den Sinn gekommen ist.
Gansel: Nachdem Ihr erster Gedichtband 1982 erschienen war, haben Sie sich allerdings erfolgreich für ein Studium am Leipziger Literaturinstitut beworben. Dort studierten Sie dann ab 1980.
Schmidt: Es wurde dort ein Sonderkurs angeboten, der sich an Literaten richtete, die bereits ein Buch veröffentlicht hatten. Um die Arbeit an einer Folgepublikation zu fördern, sollten die Autoren, sofern sie anderweitig berufstätig waren, mit einem Stipendium von 500 DDR-Mark monatlich für ein Jahr freigestellt werden. Wir mussten dafür eine Woche im Monat in Leipzig anwesend sein und hatten dort Vorlesungen zu sozialistischer Landwirtschaft, sozialistischer Jugendforschung, Mikrobiologie usw. zu besuchen, also Fächer, die mit Literatur eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Insofern stimmt es eigentlich nicht, dass ich am Literaturinstitut studiert hätte. Ich war damals nach Berlin gezogen, hatte dort als Psychologin aber keine Arbeit bekommen und wollte keinen Job als Sachbearbeiterin oder so etwas annehmen. Insofern bewarb ich mich eher notgedrungen am Literaturinstitut, um irgendwoher Geld zu bekommen.
Gansel: Dann überwiegen bei Ihnen eher die schlechten Erinnerungen an Leipzig?
Schmidt: Nein, ich habe sehr schöne Erinnerungen. Damals war noch Adolf Endler dort, wir waren oft bei ihm in der Steinstraße zur Lesung. Die Leute, die mit mir dort waren, zum Beispiel Wolfgang de Bruyn, Wolfgang Trampe und Brigitte Struzyk, waren schon eine ganz gute Truppe. Aber die Inhalte, die man uns im Rahmen des Studiengangs vermittelt hat, waren für mich gänzlich irrelevant.
Gansel: Sie haben als Lyrikerin begonnen. Wann und wie ist es dazu gekommen, dass Sie dann zur Prosa geraten sind?
Schmidt: Der Zeitpunkt resultiert im Grunde aus ganz pragmatischen Gründen. Ich war berufstätig, hatte vier, später dann fünf Kinder. Da blieb zunächst einfach keine Zeit zum Prosa-Schreiben. Meine Gedichte sind, wie früher beim Klavierspiel, einfach so nebenbei im Kopf gewachsen. Egal, ob ich nun kochte oder Windeln wusch. Ich brauchte sie hinterher nur noch aufzuschreiben und dazu blieb dann doch genug Zeit. Ich musste auch fast nie etwas überarbeiten, die Texte kamen fertig aufs Papier. Ideen für Prosastoffe trug ich schon sehr lange mit mir herum. Aber es war niemals ausreichend Gelegenheit, mich sechs, acht Stunden hinzusetzen, um in einem Stück zu schreiben. Entsprechend habe ich mich, als ich mich 1994 für die Freiberuflichkeit entschied, sofort an meinen ersten Roman Die Gunnar-Lennefsen-Expedition gesetzt, der dann 1998 erschienen ist.
Gansel: Sie sagen, als Mutter von fünf Kindern sei nur Zeit für Gedichte geblieben. Hat die Arbeitsbelastung als Mutter Ihre literarische Arbeit denn auch in anderer Hinsicht beeinflusst? Man merkt dem ersten Roman durchaus an, dass dahinter spezifische Erfahrungen stehen.
Schmidt: Na ja, ich habe mich dadurch für die Probleme von Frauen schon stärker interessiert als eine Autorin, die vielleicht keine Kinder hat oder gar als ein Mann, der zu seinen Kindern nicht so ein enges Verhältnis hat. Die Gunnar-Lennefsen-Expedition ist durch diese spezifischen Erfahrungen auf jeden Fall sehr beeinflusst worden. Mir war auch aufgefallen, dass Männer, wenn sie sich über Geschichte unterhalten, vor allem Jahreszahlen aufsagen oder Schlachten aufzählen. Es waren demgegenüber die Frauen, die während Kriegszeiten dafür gesorgt haben, dass die Familie etwas zu essen hatte. Und die, während diese oder jene Schlacht unter Männern stattfand, eben z.B. Brennholz beschafft haben. Insofern ist die Erinnerung von Frauen oft an ganz andere Dinge geknüpft als bei Männern. Dies hätte ich ohne meine eigenen Erfahrungen als Frau und Mutter sicherlich nicht wirklich authentisch darstellen können.
Gansel: Erinnerung spielt ja eigentlich in allen Ihren Texten eine Rolle. Hat das Erinnern auch für Sie persönlich eine besondere Bedeutung? Halten Sie es z.B. mit Christa Wolf, die beständig Tagebuch führt oder eher mit Peter Härtling, der im Gespräch einmal gesagt hat, ein Tagebuch, das wäre für ihn überhaupt nichts?
Schmidt: Ein Tagebuch habe ich auch noch nie geführt. Das heißt, ich habe es immer mal wieder versucht, wenn man mir geraten hatte, eines zu führen. Mehr als zwei, drei Eintragungen sind es aber nie geworden. Ich kann einfach kein Tagebuch schreiben. Ich halte mein Leben auch nicht für so mitteilungswert, dass ich daraus irgendwann mal etwas machen möchte. Abgesehen davon, dass das Gedächtnis die Wirklichkeit ohnehin immer verfremdet.
Gansel: Von heute am betrachtet, sind Sie mit ihrer Prosa erfolgreicher als mit der Lyrik.
Schmidt: Wie man es nimmt. Finanziell betrachtet stimmt das natürlich. Es ist ja immer so, dass man von Gedichten nicht leben kann. Aber trotzdem fühle ich mich weiterhin eher als Lyrikerin, denn als Prosa-Autorin. Hinzu kommt, dass mir ja 2002 ein Aneurysma im Kopf geplatzt ist. Seitdem habe ich nicht mehr dasselbe Lesetempo wie früher. Es fällt mir immer schwerer, ein Buch zu lesen und ich habe das Gefühl, dass ich deshalb auch nicht mehr richtig hinterherkomme, was die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Prosa anbelangt. Im Bereich der Lyrik geht es noch, da behalte ich den Überblick ganz gut, wie ich glaube.
Gansel: Sie weisen bereits auf Ihren autobiografisch fundierten Roman Du stirbst nicht hin. Dort stellt sich die Hauptfigur Helene Wesendahl die Frage: „Was ist ein Gedicht?“ Kann man diese Frage denn beantworten?
Schmidt: Mein Begriff von einem Gedicht hat sich über die Jahre hinweg ziemlich verändert. Früher habe ich – ich glaube, ohne es bewusst gedacht zu haben – Ausdruck gesucht für etwas, was ich sagen, aber nicht direkt aussprechen wollte. Heute gehe ich an ein Gedicht ganz anders heran. Ich versuche, die Sprache zu kneten und zu sehen, was herauskommt, wenn ich mit ihr experimentiere. Ein Gedicht ist für mich so etwas wie eine kleine Berührungsfläche zwischen disparaten Phänomenen, die mir beschreibungswert scheinen, ein momentanes Berühren kleiner Augenblicke.
Gansel: Welche Art von Lesern steht Ihnen denn vor Augen, wenn Sie über Ihre eigenen lyrischen Texte nachdenken? Oder spielt der potentielle Leser bei diesem Schaffensprozess eher keine Rolle?
Schmidt: Die Leser spielen für mein lyrisches Schreiben eigentlich gar keine Rolle. Ich verfasse die Gedichte nicht für andere Leute. Es interessiert mich deshalb nicht wirklich, ob meine Gedichte von vielen gelesen werden. Solange sie der Verlag druckt, reicht mir das. Wenn er sie nicht drucken würde, wäre das auch nicht so schlimm. Meine Gedichte entspringen einfach so sehr meinem Verhältnis zur Welt, dass ich sie immer niederschreiben würde, unabhängig davon, ob sie jemals einen Gedichtband abgäben oder ob sie jemand liest.
Gansel: Wie lesen Sie denn Gedichte anderer Autoren?
Schmidt: Mich interessieren Gedichte immer so weit, wie sie etwas sprachlich transportieren, das mich irgendwie zu bewegen vermag. Zuletzt waren das zum Beispiel die Gedichte von Marion Poschmann. In gute Lyrik vertiefe ich mich gerne so lange, bis die Texte etwas mit mir machen. Wenn sie mich tatsächlich erreichen, setzen gute Gedichte in mir selbst einen Prozess frei, aus dem sich dann wieder Gedichte ergeben. Das hat aber eigentlich erst nach meiner Krankheit so zu funktionieren begonnen. Das erste Erlebnis dieser Art hatte ich mit Ron Winkler auf einer Lesung 2007 in Greifswald. Es waren auch Gerhard Falkner und Ulrike Almut Sandig dabei. Alle lasen ganz neue Texte. Nur ich las aus meinem letzten Band von 2000. Das war noch die Zeit, in der ich kein Gedicht schreiben konnte. Ich fühlte mich gegenüber den anderen so unvollkommen auf diesem Podium. Ich hatte das Gefühl, nichts von dem zu verstehen, was Ron Winkler las. Das habe ich ihm anschließend im Zug nach Hause dann auch gesagt, aber auch, dass mich seine Gedichte trotzdem sehr angesprochen hatten, weil sie irgendetwas in mir zum Klingen brachten. Ich habe mir daraufhin alle Bücher von ihm gekauft und habe versucht, das Prinzip zu knacken, nach dem diese Texte gemacht sind. Und in dem Moment, als ich meinte, das geschafft zu haben, konnte ich wieder selber anfangen, Gedichte zu schreiben. Was das nun war, das ich geknackt hatte, kann ich gar nicht genau sagen. Ich möchte Schreibprozesse auch gar nicht völlig durchschauen. Wenn ich das könnte, dann könnte ich wohl nicht mehr selbst schreiben.
Gansel: Sie haben bereits den persönlichen Einschnitt des Jahres 2002, ihre schwere Krankheit, angesprochen. Könnte man in Ihrem Fall generell von einer Art zweitem Prozess des Spracherwerbs sprechen?
Schmidt: Es war eher ein Wiedererwerben. Ich konnte in den ersten zwei, drei Jahren bestimmte Aussagen zunächst nicht verstehen, ganz einfache, alltägliche Wortkombinationen. Es ging mir ganz oft so, dass ich zwei zueinander gehörende Wörter nicht zusammengebracht habe im Kopf. Weil sie für sich völlig unterschiedliche Bedeutungen hatten, verstand ich den Zusammenhang zwischen ihnen nicht.
Gansel: Wie hat sich der Sprachverlust als eine der Folgen der Gehirnblutung auf Ihr literarisches Schaffen ausgewirkt. Schreiben Sie heute anders als vorher?
Schmidt: Die Frage ist schwierig zu beantworten. Ich wäre seitdem ja ohnehin zehn Jahre älter geworden und hätte mich in diesem langen Zeitraum literarisch womöglich weiterentwickelt. Andererseits lässt sich nicht wirklich spekulieren, wie ich ohne diese Erkrankung heute schreiben würde. Es ist aber natürlich zunächst ein anderes Schreiben gewesen. Ich habe fünf Jahre lang überhaupt kein Gedicht schreiben können. Ich konnte mir unter einem Gedicht nichts mehr vorstellen, wusste auch nicht, wie ich jemals wieder zur Lyrik hinkommen würde. Allerdings war es so, dass ich auch während der Erkrankungsphase besser zu schreiben als zu sprechen vermochte. Mein Mann brachte mir den Laptop mit ins Krankenhaus, um mir auf diese Weise zu helfen, etwas auszudrücken und zu formulieren, was mündlich nicht so gut ging. Das Schriftsprachliche funktionierte schneller und besser als das Mündliche und das hatte mir ja seit je entsprochen. Und so fing ich bereits ein dreiviertel Jahr nach dem Vorfall, als ich noch sechs, sieben Mal am Tag eingeschlafen bin und höchstens eine Stunde am Stück schreiben konnte, bereits mit einem neuen Roman an, nämlich Seebachs schwarze Katzen. Ich bezeichne den Text als meinen therapeutischen Roman, weil es mir durch ihn gelang, mich aus diesem Sumpf der Sprachlosigkeit herauszuziehen. Er mag bestimmt mein schwächster Roman sein, aber ich kann trotzdem zu ihm stehen. Als ich die Arbeit am Text abgeschlossen hatte, war ich überzeugt, dass es weitergehen würde.
Gansel: Es gibt eine Aussage von Uwe Johnson, die ich gerne zitiere, weil ich glaube, dass sie für viele literarische Texte zutrifft. Johnson sagte einmal: „Die Geschichte sucht, sie macht sich ihre Form selbst.“ Würden Sie sagen, dass das für Ihren Roman Du stirbst nicht auch zutrifft?
Schmidt: Auf jeden Fall. Ich habe ganz instinktiv begonnen mit kleinen, kurzen Abschnitten und einfachen Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätzen. Und es ergab sich einfach so, dass diese Abschnitte im Laufe des Romans mit dem wiedergewonnenen Sprachvermögen der Protagonistin auch länger werden, sich verschleifen und komplizierter werden. Insofern bildet die Form des Romans den Inhalt in der Tat ziemlich genau ab.
Gansel: Demnach spielt intuitives Schreiben bei Ihnen eine wichtige Rolle. Demgegenüber hat sich etwa Heinrich Böll riesige Pläne an die Wand genagelt, auf denen er Figuren und Konfliktlinien vorgezeichnet hat. Wie ist das bei Ihnen?
Schmidt: Ich habe noch nie für einen Prosatext eine ausführliche Planskizze gemacht. Das Konzept für die Die Gunnar-Lennefsen-Expedition bestand aus einer Din Aa-Seite, auf der es eine linke Spalte und eine rechte Spalte gab. Die eine Seite fixierte das Geschehen des Jahres 1976, die andere Seite verzeichnete die Inhaltsebene, die das ganze Jahrhundert fasste. Aufgrund dieser Zusammenstellung war mir schon irgendwie klar, wie das Ganze laufen soll. Ich habe dann aber einfach angefangen zu schreiben und der Roman hat sich von diesem Konzept schnell ziemlich entfernt. Ich brauchte eigentlich überhaupt nichts.
Gansel: Christa Wolf hat über ihren letzten Roman Stadt der Engel gesagt, er würde dort nur so getan, als ob das Dargestellte autobiografisch sei. Es finde sich darin so viel Erfundenes, dass von biografischer Grundierung nur bedingt geredet werden könne. Wie ist das mit Ihrem Roman?
Schmidt: Na ja, ich hatte Du stirbst nicht eigentlich als einfachen Krankheitsbericht angefangen. Als die therapeutische Phase zu Ende war, wollte ich das alles zunächst einmal nur für mich aufschreiben, um vielleicht irgendwann später an das Thema nochmal heranzugehen. Als ich dann dreißig Seiten geschrieben hatte, schickte ich sie einer Freundin. Die meinte, wenn ich die erste Seite zur letzten machen würde, dann hätte ich ein wunderbares Gerüst für einen Roman, weil auf diese Weise nachgezeichnet werden könnte, wie die Protagonistin an den Punkt kommt, an dem sie Erinnerung, Sprache, ja ihr Leben wiederfindet. Das leuchtete mir sofort ein. Als also klar war, dass aus dem Entwurf ein Roman werden würde, habe ich die Hauptfigur Helene ziemlich weit weg von mir geschickt. Sie behielt zwar bestimmte Ausgangsdaten von mir, etwa, dass sie Schriftstellerin ist. Dies beizubehalten schien mir in der Auseinandersetzung mit dem Lektorat wichtig, denn das Existenzielle eines Sprachverlustes ist für eine Autorin doch weit schlimmer als für eine andere Berufsgruppe. Dass Helene Wesendahl mit bestimmten biografischen Analogien ausgestattet war, hat mich vor allem aber dabei unterstützt, in Bezug auf die Darstellung der Krankheit richtig auf meine Erinnerung zugreifen zu können. Alles, was mit der Krankheit zusammenhing, habe ich also tatsächlich aus der Erinnerung geschöpft, es sind Geschehnisse, wie sie sich als Erinnerungen in meinem Kopf abgebildet haben. Aber der Rest der Handlung ist völlig frei erfunden.
Gansel: Zugespitzt könnte man behaupten, wer eine Geschichte schreibt, erzählt immer auch etwas von sich. Wo liegt bei Ihnen das Gewicht zwischen diesen beiden Polen?
Schmidt: Mir geht es wirklich um das Geschichtenerzählen. Wenn ich mit einem Roman fertig bin, dann hat sich seine Geschichte schon so weit von mir entfernt, dass ich überhaupt nicht mehr das Gefühl habe, sie hätte etwas mit mir zu tun. Ich nehme einen früheren Roman von mir nochmal zur Hand und kann nicht glauben, dass ich das geschrieben habe. Ich habe gestern ein Gedicht gefunden, das ist vielleicht acht Wochen alt. Es muss von mir sein, aber ich kann mich nicht daran erinnern, es geschrieben zu haben.
Gansel: Sie sprachen von Ihrem Roman Seebachs schwarze Katzen als einem therapeutischen Text. War Du stirbst nicht nicht auch so etwas wie eine Therapie?
Schmidt: Nein, das würde ich nicht sagen. Die Therapie lag in jeder Hinsicht hinter mir, als ich mit Du stirbst nicht begann. Erst durch meine Freundin bin ich darauf gekommen, dass aus meinem eigenen Erleben tatsächlich ein Roman werden könnte. Mit Therapie hatte das dann nichts mehr zu tun.
Gansel: Sie haben ja Psychologie studiert, einige Jahre als Psychologin gearbeitet. Inwieweit spielen diese Kenntnisse eine Rolle bei dem, was Sie schreiben?
Schmidt: Na ja, ich habe mit dem Beruf schon 1991 und dann auch innerlich völlig abgeschlossen. Aber eine langjährige Tätigkeit prägt einen immer. Ich habe zum Beispiel einen veränderten Blick auf die Menschen behalten, den ich nicht einfach abstreifen kann. Aber für die Darstellung der Bewusstseinsebene von Romanfiguren versuche ich stets, die Psychologie weitgehend außen vor zu lassen. Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen als psychologisierende Prosa.
Gansel: Hat Sie der Erfolg von Du stirbst nicht überrascht?
Schmidt: Allerdings. Das Buch war ja im Februar erschienen und dümpelte anfangs mit eher mäßigen Verkaufszahlen auf dem Buchmarkt herum, wie alle meine Bücher. Dass es dann nach mehr als einem halben Jahr den Deutschen Buchpreis gewann, das hat mich mehr als überrascht. Wer denkt denn an so was? Und plötzlich schossen die Verkaufszahlen in die Höhe. Bis Weihnachten waren 150.000 Exemplare verkauft. Von so etwas hätte ich bis dahin ja nur träumen können. Das wird es auch bei keinem meiner künftigen Bücher wieder geben, das ist mir klar. Es ist ein richtiger Medienhype, der inzwischen um den Buchpreis betrieben wird.
(Das Gespräch mit Kathrin Schmidt wurde geführt am 11. November 2011 im Rahmen der 4. Hans Werner Richter Literaturtage in Bansin/Insel Usedom.)
Aus Carsten Gansel: Literatur im Dialog. Gespräche mit Autorinnen und Autoren 1989–2014, Verbrecher Verlag, 2015
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Interview +
Lesung + Laudatio + Christine Lavant Preis + Urheberrecht
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Kathrin Schmidt in der Sendung „typisch deutsch“.


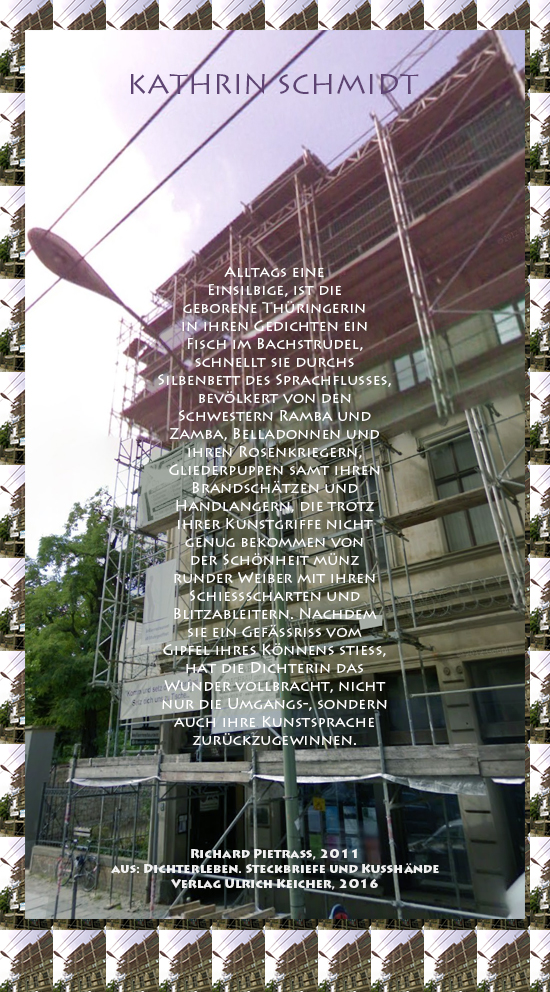












Schreibe einen Kommentar