Michael Krüger: Reginapoly
NACHGEDICHT
Die Zeichen sprechen
eine andere Sprache:
das ist ihr gutes Recht.
Wir haben uns zu fest
auf ihre Zweideutigkeit
verlassen,
jetzt sind wir beleidigt
und schweigsam. Schon wieder
sitzen wir fest
auf fremden Stühlen und wühlen
ergeben in Papierbergen. Vieles
reimt sich wieder,
was uns vor ein paar Jahren
wie ein Versprechen vorkam.
Nachwort
Das war gestern und ist lange her: Vor vier Jahren erschien diese Sammlung von Gedichten, die etwa ab 1970 entstanden, zum ersten Mal. Für mich bedeuten sie die Summe der berliner Jahre, der Zeit, die für meine Gedanken und Handlungen, für mein Leben entscheidend war. In Berlin bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen, dort habe ich gelernt, was eine Stadt ist und welche Gründe es gibt, sie zu hassen. In Berlin habe ich früh erfahren, was Politik ist und wie man sich ihr entzieht. In Berlin durfte man Fehler machen: die Stadt war das großangelegte, unbescheidene Experiment, Geschichte und Gegenwart in immer neuen, hochsubventionierten Versuchsreihen aneinander scheitern zu lassen. In dieser explosiven und idyllischen, anarchischen und kleinbürgerlichen Stadt, in der alle meine Freunde wohnen, die mir, außerhalb von Schulen und Universitäten, etwas beigebracht haben, in Berlin liegt der Grund für diese Gedichte.
Als ich Ende der sechziger Jahre nach München zog, erfuhr ich zum ersten Mal, was es heißt, in der Bundesrepublik zu leben. Die Konturen des Politischen zerflossen, die Physiognomien, die ich aus Berlin kannte, waren hier unbekannt. Der Unterschied war so beträchtlich in nahezu jeder Hinsicht, so verwirrend und entmutigend noch da, wo es eine Erleichterung bedeutete, hier zu leben, daß ich anfing, meine berliner Erfahrungen zu notieren: in der Reproduktion wollte ich die Quelle, die zu versiegen drohte, am Sprudeln halten, um in der Wüste des fortschrittlichen Westdeutschland nicht zu verdursten. Diese Form einer alltagsbezogenen Magie, die einem Gefangenen helfen mag, im Kerker zu überleben, taugt nicht für einen Angestellten, dessen Beruf es ist, sich mit der Wirklichkeit, für wie schäbig er sie auch hält und wie vermittelt er sie auch wahrnimmt, zu beschäftigen. Wenn ich also mit Hilfe des Schreibens das doppelte Problem, vor dem ich stand, lösen wollte, mußte ich eine Form finden, die sowohl die Stimmen der Vergangenheit wie die der Gegenwart miteinander konfrontieren konnte. Was lag näher als ein dialogisches Prinzip? Um der Gefahr zu entgehen, einem Argument lediglich ein Gegenargument gegenüberzustellen, einer Idee deren Negation, um also nicht beim Traktat zu enden, an dessen Ende ein Ergebnis steht, teilte ich die wimmelnden Gedanken, die meinen Kopf allesamt mit dem Anspruch durchzogen, wahr zu sein, auf viele Stimmen auf – was auch ganz und gar meiner durch Beobachtung entstandenen Meinung entsprach, daß das, was wir „Identität“ nennen, weitgehend vom Zufall abhängig ist. Unsere Gesellschaft tut zwar alles, uns einzureden, wir kämen zu unserer Identität, wenn wir die angebotenen Institutionen nur benutzen, also von der Geburt bis zum Tod uns „richtig“ verhalten, aber jeder hat am eigenen Leibe gespürt, wie trügerisch und brüchig Institutionen sind und mit welcher Geschwindigkeit sie ihre ideologische Begründung ändern. Merkwürdigerweise ist die Idee, daß man ein anderer hätte werden können – oder sogar viele andere –, in unsere Gesellschaft verpönt, wo man ein Leben dann für erfüllt hält, wenn es geradlinig verlaufen ist – und mit Erfolg gekrönt. Aber Geradlinigkeit, dieses bewunderte Resultat der modernen Vernunft, ist eine enge Maske, die den Blick, aus einem starren, immergleichen Winkel kommend, in immer die gleiche Richtung zwingt. Ein solcher Blick ist konstitutionell nicht fähig, die vielen Möglichkeiten, die in jeder Person liegen, wahrzunehmen, er kennt nur die eine, die vor ihm liegt: das hat den Vorteil, nicht wählen zu müssen. Die Nachteile, die schon kaum noch als solche begriffen werden, liegen auf der Hand. Einen nehmen wir allerdings immer wieder wahr: Wenn es schiefgeht, darf die Begründung lauten: Es gab keine andere Wahl.
Meine Vorstellung von Identität war nun das ganze Gegenteil. Da ich sie nicht „leben“ konnte, oder nur in geringem Maße, wollte ich sie wenigstens beschreiben. Ich wollte das Gedicht zu einem Ort vieler sich widersprechender.Stimmen machen, wobei jede Stimme für eine Möglichkeit stehen sollte. Zugegeben, ein hochgestecktes Ziel, das nicht zuletzt eine Antwort auf die damals diskutierte Meinung sein sollte, Literatur habe in der bürgerlichen Gesellschaft jede Fähigkeit verloren, Erkenntnis zu vermitteln. Mein Versuch einer Antwort schien für mich deshalb so wichtig, weil ich ständig die gegenteilige Erfahrung machte: jenseits der Frage, ob Literatur als Kunst Illusion sei, die nur solange undurchschaut bleibt, solange wir das Leben als Mangel begreifen und unabhängig davon, ob mit Literatur dieser Mangel zu beheben sei (wahrscheinlich nicht), jenseits dieser Fragen war das Gedicht für mich zunächst der Ort, wo ich Erkenntnisse ausprobieren konnte. Ein lebensnotwendiges Feld, das stand (und steht) außer Frage.
Michael Krüger, Juli 1978, Nachwort aus der Taschenbuchausgabe von Reginapoly beim Wilhelm Heyne Verlag 1980
In diesen Gedichten
wird häufig über erwünschte Erfahrungen und verpaßte Gelegenheiten gesprochen: sie beschreiben einen Mangel. Dieser ist mit Gedichten nicht wegzuschreiben, allenfalls lesbarer zu machen.
Carl Hanser Verlag, Klappentext, 1976
Lyrik
… Links
der Spiegel, das Duplikat, die Uebersetzung; rechts
die Revolution, die Aufstände, die Veränderungen.
Vor mir die Unendlichkeit des weissen Papiers,
berichtest du,
schreibe ich mir auf, für
später. Für die Arbeit an einem Gedicht
über das Schreiben
von Gedichten.
Mit diesen Worten schliesst das „Vorgedicht“, nach „Widmung“ der zweite Text in dem Lyrikband Reginapoly von Michael Krüger (im Carl Hanser Verlag München). Krüger, 1943 geboren, lebt als Verlagslektor in München; er hat einige Bücher ediert – zum Beispiel mit Klaus Wagenbach die Jahrbücher Tintenfisch – und ist seit dem Sommer dieses Jahres neben Hans Bender Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Akzente. In einigen Zeitschriften waren in letzter Zeit Gedichte von Krüger gedruckt worden; Reginapoly ist der erste Sammelband mit Gedichten Michael Krügers.
Dies ist Gedankenlyrik, gespeist von der „Kopfwirklichkeit“, während die Aussenrealität allenfalls die Funktion des Auslösers für Reflexionen hat. Erlebnisse und Erfahrungen sind von zweifelhaftem Wert, denn gelegentlich verdichtet es sich zur „Gewissheit, / dass der grösste Teil der Erfahrungen Einbildungen / sind: misslungene Spiele / der Einbildungskraft, erfundene Erinnerungen“. In Wahrheit nämlich liegen „Meine wüsten Landschaften, / meine vier Meere, / mein ununterbrochener Horizont / … direkt hinter den Augen“.
Misstrauen gilt auch der Subjektivität, der neuen „Ich-Seuche“ und „Ich-Pest“:
hör doch nicht auf diese
schwitzenden Ich-Sager, glaube doch nicht dieser Rede
in einfachen Aussagesätzen, die ohne Zunge
auskommt, ohne Herz, ohne Kopf und ohne Körper,
die sich verkrochen hat
in der Sprache jenes alten, berühmten Ich, das den Bach hinunter ist,
endgültig und gleichgültig und unauffindbar.
Ueberdruss richtet sich gegen „die Kopien, diese Flut von / Kopien täglich“, gegen das Leben und Sprechen und Denken in bereits vorliegenden Rastern:
Ueber das Reden
sprechen und über das Schweigen reden, das
ist auch nur ein kümmerlicher Einfall. Und
wo die Einfälle herkommen wissen wir auch.
Michael Krügers meist sehr lange Gedichte sind – wenn das Paradox erlaubt ist – dialogische Monologe: das Ich richtet sich an eine immer gegenwärtige „sie“, die als Gesprächspartnerin und Gegnerin auftritt, aber doch wohl vor allem eine Projektion des Ich ist und dessen eigene Zweifel und Einwände artikuliert. Diese rhetorisch angelegten Selbstgespräche sind oft zu Zeilen gebrochene Prosa, kaum jedoch Lyrik im strengen Sinne: lyrische Essays oder Essay-Lyrik könnte man Krügers Texte nennen, in denen die Realität der Innenwelt über die Aussenwelt dominiert. Auch die Widmungen an Figuren, unserer Literaturszene deuten darauf hin, dass dies weithin Insider-Poesie ist: durchreflektiert, selbstkritisch, klug und nervös, aber selten in der Sphäre der Realien und der Bilder verankert.
Krügers Texte beschreiben ein Dilemma, das sie selbst nicht lösen können: Auf der einen Seite ist ein tiefes Unbehagen spürbar gegenüber der treffenden, brillanten Aussage, die tödlich wirkt („Aphorismen beschreiben die Welt mit tödlicher Klarheit.“) – auf der anderen Seite aber bleibt die Sehnsucht nach der bündigen, der alles ausdrückenden und erklärenden Formulierung:
Du weisst was ich meine,
ein riesiges Gerüst aus Sätzen, Erklärungen und
Fussnoten, ein stabiler Totalsatz schwebt mir vor,
eine Art Haussatz, in dem ich wohnen kann, der
sozusagen in mir wohnt, mich ganz ausfüllt…
J.P. Wallmann, Die Tat, 12.11.1976
Reginapoly, 1976
Mein erster Gedichtband, Reginapoly, erschien 1976, ich war dreiunddreißig Jahre alt – also in einem Alter, in dem die Berufenen und Auserwählten bereits die erste Ausgabe ihrer Gesammelten Gedichte in den Händen halten. Natürlich hatte auch ich schon vorher geschrieben, aber die Vorstellung, diese Texte auch zu veröffentlichen, wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Wer veröffentlicht, hat einen Adressaten im Sinn, auch wenn dieser Angesprochene sich noch verhüllt. Ich war Verlagslektor, gab mit meinem Freund Klaus Wagenbach den Tintenfisch heraus, interessierte mich, als Neu-Münchner, für Gesellschaftstheorie und Anthropologie, für Theater und Ästhetik, ich schrieb Artikel und Rezensionen für Rundfunk und Zeitungen, weil es mir offenbar wichtiger erschien, statt Gedichten meine Ansicht zu bestimmten Problemen und Büchern zu veröffentlichen. Vielleicht war ich auch von den politischen Umständen affiziert: daß einer seine Zeit mit dem Schreiben von Gedichten verbrachte, gehörte nicht gerade zu den gängigen Vorstellungen einer glücklichen Berufswahl. Dabei waren mir Gedichte seit meiner Jugend das Wichtigste im Leben; daran hat sich bis heute nichts geändert.
Vier Jahre nach der Veröffentlichung bei Hanser erschien Reginapoly als Taschenbuch bei Heyne. Ja, man reibt sich die Augen, aber damals wurden bei Heyne in der von Manfred Kluge betreuten Reihe Heyne-Lyrik tatsächlich Eugenio Montale und Tomas Tranströmer, W.H. Auden und Allen Ginsberg, Hans Arp und Vasco Popa veröffentlicht. Für diese Ausgabe bat mich Manfred Kluge um ein Nachwort, das ich hier noch einmal zitiere:
Das war gestern und ist lange her: Vor vier Jahren erschien diese Sammlung von Gedichten, die etwa ab 1970 entstanden, zum ersten Mal. Für mich bedeuten sie die Summe der Berliner Jahre, der Zeit, die für meine Gedanken und Handlungen, für mein Leben entscheidend war. In Berlin bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen, dort habe ich gelernt, was eine Stadt ist und welche Gründe es gibt, sie zu hassen. In Berlin habe ich früh erfahren, was Politik ist und wie man sich ihr entzieht. In Berlin durfte man Fehler machen: die Stadt war das großangelegte, unbescheidene Experiment, Geschichte und Gegenwart in immer neuen, hochsubventionierten Versuchsreihen aneinander scheitern zu lassen. In dieser explosiven und idyllischen, anarchischen und kleinbürgerlichen Stadt, in der alle meine Freunde wohnen, die mir, außerhalb von Schulen und Universitäten, etwas beigebracht haben, in Berlin liegt der Grund für diese Gedichte.
Als ich Ende der sechziger Jahre nach München zog, erfuhr ich zum ersten Mal, was es heißt, in der Bundesrepublik zu leben. Die Konturen des Politischen zerflossen, die Physiognomien, die ich aus Berlin kannte, waren hier unbekannt. Der Unterschied war so beträchtlich in nahezu jeder Hinsicht, so verwirrend und entmutigend noch da, daß ich anfing, meine Berliner Erfahrungen zu notieren: in der Reproduktion wollte ich die Quelle, die zu versiegen drohte, am Sprudeln halten, um in der Wüste des fortschrittlichen Westdeutschland nicht zu verdursten. Diese Form einer alltagsbezogenen Magie, die einem Gefangenen helfen mag, im Kerker zu überleben, taugt nicht für einen Angestellten, dessen Beruf es ist, sich mit der Wirklichkeit, für wie schäbig er sie auch hält und wie vermittelt er sie auch wahrnimmt, zu beschäftigen. Wenn ich also mit Hilfe des Schreibens das doppelte Problem, vor dem ich stand, lösen wollte, mußte ich eine Form finden, die sowohl die Stimmen der Vergangenheit wie die der Gegenwart miteinander konfrontieren konnte. Was lag näher als ein dialogisches Prinzip? Um der Gefahr zu entgehen, einem Argument lediglich ein Gegenargument gegenüberzustellen, einer Idee deren Negation, um also nicht beim Traktat zu enden, an dessen Ende ein Ergebnis steht, teilte ich die wimmelnden Gedanken, die meinen Kopf allesamt mit dem Anspruch durchzogen, wahr zu sein, auf viele Stimmen auf – was auch ganz und gar meiner durch Beobachtung entstandenen Meinung entsprach, daß das, was wir ,Identität‘ nennen, weitgehend vom Zufall abhängig ist. Unsere Gesellschaft tut zwar alles, uns einzureden, wir kämen zu unserer Identität, wenn wir die angebotenen Institutionen nur benutzen, also von der Geburt bis zum Tod uns „richtig“ verhalten, aber jeder hat am eigenen Leibe gespürt, wie trügerisch und brüchig Institutionen sind und mit welcher Geschwindigkeit sie ihre ideologische Begründung ändern. Merkwürdigerweise ist die Idee, daß man ein anderer hätte werden können – oder sogar viele andere −, in unserer Gesellschaft verpönt, wo man ein Leben dann für erfüllt hält, wenn es geradlinig verlaufen ist – und mit Erfolg gekrönt. Aber Geradlinigkeit, dieses bewunderte Resultat der modernen Vernunft, ist eine enge Maske, die den Blick, aus einem starren, immer gleichen Winkel kommend, in immer die gleiche Richtung zwingt. Ein solcher Blick ist konstitutionell nicht fähig, die vielen Möglichkeiten, die in jeder Person liegen, wahrzunehmen, er kennt nur die eine, die vor ihm liegt: das hat den Vorteil, nicht wählen zu müssen. Die Nachteile, die schon kaum noch als solche begriffen werden, liegen auf der Hand. Eines nehmen wir allerdings immer wieder wahr: Wenn es schiefgeht, darf die Begründung lauten: Es gab keine andere Wahl.
Meine Vorstellung von Identität war nun das ganze Gegenteil. Da ich sie nicht ,leben‘ konnte, oder nur in geringem Maße, wollte ich sie wenigstens beschreiben. Ich wollte das Gedicht zu einem Ort vieler sich widersprechender Stimmen machen, wobei jede Stimme für eine Möglichkeit stehen sollte. Zugegeben, ein hochgestecktes Ziel, das nicht zuletzt eine Antwort auf die damals diskutierte Meinung sein sollte, Literatur habe in der bürgerlichen Gesellschaft jede Fähigkeit verloren, Erkenntnisse zu vermitteln. Mein Versuch einer Antwort schien für mich deshalb so wichtig, weil ich ständig die gegenteilige Erfahrung machte; jenseits der Frage, ob Literatur als Kunst Illusion sei, die nur so lange undurchschaut bleibt, solange wir das Leben als Mangel begreifen, und unabhängig davon, ob mit Literatur dieser Mangel zu beheben sei (wahrscheinlich nicht), jenseits dieser Fragen war das Gedicht für mich zunächst der Ort, wo ich Erkenntnisse ausprobieren konnte. Ein lebensnotwendiges Feld, das stand (und steht) außer Frage.
Ich gestehe, daß ich seither diese Gedichte nicht mehr angeschaut habe. Wenn ich den Band irgendwo öffne, springt mir ein verstecktes Zitat ins Auge, Nietzsche, Bataille, was ich damals las. Also lieber nicht noch einmal lesen. Lieber noch warten, bis man wirklich ein anderer geworden ist. Oder, was wahrscheinlicher ist, vergeblich warten. Mit großer Freude habe ich bemerkt, daß ich mit allen Menschen, denen einzelne Gedichte gewidmet sind, noch befreundet bin: Karl Heinz Bohrer und Fred Oberhauser, Ludwig Harig und Henning Ritter, Peter Hamm und Urs Widmer. Aus allen sind originelle Schriftsteller geworden. Und aus der Architektin Regina Poly, an die dieser Band gerichtet war, ist mittlerweile eine Gartenarchitektin geworden. Sie hat sich wirklich geändert.
Michael Krüger, aus: Renatus Deckert (Hrsg.): Das erste Buch, Suhrkamp Verlag, 2007
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Peter von Becker: Archäologie des Fortschritts
Süddeutsche Zeitung, 7.4.1976
Georg Jappe: Ende der Utopie
Die Zeit, 2.7.1976
Christian Linder: Das Ausprobieren unserer Stimmen
Frankfurter Rundschau, 31.7.1976
Peter Hamm: Ein rosa Katzenjammer
Der Spiegel, 16.8.1976
Peter Demetz: Abgeblühte Gärten der Poesie
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.3.1977
Elisabeth Andres: Gedanken zur Lage der neuen deutschen Lyrik
Merkur, Heft 356, Januar 1978
Die Wege des Dichters
– Ein Gespräch zwischen Michael Krüger und Piero Salahè. –
Piero Salahè: Michael Krüger, Sie sind Dichter, Romanautor, Verleger und Herausgeber. Führen diese verschiedenen Rollen ein friedliches und befruchtendes Zusammenleben?
Michael Krüger: Ich weise gern auf den Satz von Novalis hin, daß „jeder Mensch eine kleine Gesellschaft“ ist. Gesellschaften mußten über die Jahrhunderte Institutionen erfinden, damit sich die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft nicht gegenseitig umbringen. Der ganze Zivilisationsprozeß, den wir durchlaufen haben, ist nichts als ein solcher Versuch und spiegelt sich in jedem einzelnen Menschen wider. Von dieser Gesellschaft, die man ist, spaltet sich immer einer ab, der die meiste Zuwendung bekommt, der fürs Arbeiten zuständig ist, der eine Familie gründet usw., während die anderen ein Schattendasein führen. Es ist ein Merkmal von zivilisierten Gesellschaften, daß in jedem einzelnen Menschen eine Ausrichtung gefördert wird. Das ist unsere Vorstellung von Identität. Zum Glück interessieren sich bei mir alle diese verschiedenen Figuren für Literatur. Es ist keiner da, der die anderen zu ermorden trachtet. Die Menschen in mir pflegen einen höflichen Umgang miteinander, die Konflikte entstehen hauptsächlich wegen der Zeit, die jede dieser einzelnen Figuren – der Schriftsteller, der Dichter, der Verlagsmensch, der Leser und der Zeitgenosse – für sich beansprucht.
Salahè: Wie gehen Sie mit Ihrer Zeit um?
Krüger: Schreiben ist eine sehr aufwendige Tätigkeit, besonders die Prosa. Wenn man Gedichte schreibt, kommt es mehr auf die Ruhe als auf die Zeit an. Bei der Prosa muß man Ausdauer haben, während man bei der Poesie das Interesselose betrachtet, das Interesselose des Lebens fördert. Auch der Verlagsmensch beansprucht viel Zeit, eine Organisationszeit, die bezahlt wird und von der sich die vielen Menschen in mir ernähren. Mit dem Verlagsmenschen muß der Leser dauernd kämpfen, weil dieser als Lesezeit nur ein bis zwei Stunden in der Nacht anbieten kann. Schließlich gibt es auch den Zeitgenossen, der sich mit der Zeitgeschichte beschäftigt. Daß ein Schriftsteller auf der Höhe der Zeit sein muß, ist eine Forderung aus der Aufklärung. Ob das bei mir der Schriftsteller abbekommt, ist eine andere Frage, aber der Verlagsmensch muß das abbekommen, er kann nicht so tun, als existiere Literatur jenseits von Raum und Zeit. Diese fünf bis sechs Personen sind höflich miteinander, was die Inhalte angeht, aber sie kämpfen heftig um die Zeit.
Salahè: Zu den erwähnten Persönlichkeiten würde ich noch die des „Dichterfreundes“ hinzugesellen. In einem Gedicht, das Sie jüngst Wolfgang Bächler zum 80. Geburtstag gewidmet haben, schreiben Sie: „Ein Satz verbirgt sich / in jeder Freundschaft / der kommt nie / zur Sprache / nie.“ Wie wichtig waren Dichterfreundschaften in Ihrer poetischen Laufbahn?
Krüger: Sie waren mir immer außerordentlich wichtig. Es gibt zwei Möglichkeiten mit Dichtern Kontakt zu halten: Man kann sie immer wieder lesen und man kann sich mit ihnen in einen Austausch begeben, weil man sich von dieser persönlichen Freundschaft etwas Neues, Befruchtendes erhofft. Um bei Wolfgang Bächler zu bleiben, den ich seit vierzig Jahren kenne: Ich werfe mir vor, daß ich mich zu wenig um ihn kümmere. Als er noch quicklebendig war, trafen und unterhielten wir uns oft; jetzt, wo er ein alter Herr ist, sehen wir uns kaum. Eine poetische Existenz wie ihn nicht physisch um sich zu haben, ist ein großer Verlust. Früher habe ich viel über Wolfgang Bächler geschrieben und ihn damit ermuntert, weiterzuschreiben. Er hat viele Phasen durchgemacht und sich ein schreckliches Schweigen auferlegt, was auch mit mangelnder Zuneigung zu tun hatte. Er litt darunter, daß er nur in einem bestimmten Moment der Zeitgeschichte, zur Zeit der Gruppe 47, im Zentrum stand. Aus dieser Zusammenarbeit und diesem Zusammenleben sind in schneller Folge mehrere Bücher entstanden. Danach hat er geheiratet, ist aus Deutschland weggegangen, der Kontakt riß, seine Krankheit brach sich Bahn und plötzlich merkte er, daß er nicht mehr so richtig dazugehörte. Was ich daraus gelernt habe, ist, daß Schriftsteller – und ich sehe das jeden Tag im Verlag – mehr als ein Blatt Papier brauchen, auf dem sie sich verbreiten können und mehr als Zuwendung und Anerkennung durch einen Preis – sie brauchen auch den Austausch. Es ist interessant, daß gerade Schriftsteller wie Celan, die wir für die abgeschiedensten halten, die umfangreichsten Briefwechsel unterhalten. Die Briefe mit dem Ehepaar Lenz, mit Franz Wurm und mit Peter Szondi kommen nach und nach zum Vorschein, und es werden andere folgen. Man merkt, das war Celans tägliche Flaschenpost. Das Gedicht wurde in die Flasche getan und ins Meer geworfen, wo immer es auch ankam, wie er im Meridian schrieb, aber die Briefe waren wahrscheinlich lebenserhaltend. Offenbar müssen gerade Menschen, die sich durch Lesen absondern –, Lesen ist ja eine einsame Tätigkeit –, danach eine andere Phase haben, wo über dieses Gelesene gesprochen wird. Wenn man Glück hat, geht das Gelesene in einen Text über, wird von jemand gedruckt, geliebt, man bekommt einen Preis dafür. Wenn die Kette stimmt, kann aus dieser Einsamkeit eine Kommunikation entstehen, aber oft verführt diese Abschließung dazu, daß man sich ganz zurückzieht, für viele Sachen untauglich und anfällig für schlimme Infiltrationen wird. Die Seele ist eine komplizierte Angelegenheit.
Salahè: Davon abgesehen, daß Poesie in unserer Gesellschaft eine marginale Rolle spielt – ist für einen Dichter Marginalität der Berühmtheit vorzuziehen? Unter welchen Umständen gedeiht die lyrische Stimme am besten?
Krüger: Das ist eine wichtige Frage, besonders in einer Gesellschaft, die ihren Frieden mit der Kunst geschlossen hat. Es hat in der ganzen Geschichte der Kunst keine solche gesellschaftliche Akzeptanz von Kunst wie in unserer Gesellschaft gegeben, noch nie so viele Preise, Dichterstipendien, Lesungen etc. Das bringt auch Gefahren mit sich, etwa wenn bei Künstlern Ansprüche entstehen, die nicht erfüllt werden können. Einige werden dann verbittert, neidisch und sondern sich ab. Ob das ihrer poetischen Stimme gut tut, ist schwer zu sagen, weil die psychischen Unterschiede sehr groß sind. Nehmen wir Oskar Pastior, einen Dichter, der sehr komplizierte Gedichte schreibt und eine lange Anlaufzeit braucht, bis sein kleines poetisches System funktioniert, jemand, der in Berlin in einer winzigen Wohnung sitzt und schreibt. Hätte ein solcher Mensch mit seiner enormen Arbeit gar keinen Zuspruch bekommen, wäre er irgendwann wahrscheinlich vereinsamt. Deshalb ist es für ihn gut, in einer Großstadt zu leben, in zehn Minuten Entfernung vom Literaturhaus zu wohnen, Mitglied einer Akademie zu sein, in der er Leute treffen kann. Die Vorstellung, daß er in einer Stadt lebt, in der es das alles nicht gibt, wäre für mich unerträglich, weil ich befürchten würde, daß er irgendwann aufgibt. Ich meine damit nicht nur Oskar Pastior, sondern den Typus des Dichters, den er verkörpert.
Salahè: Leopardi, der abgeschieden in Recanati lebte, brauchte offenbar keine Großstadt um seine Literatur zu schreiben.
Krüger: Leopardi ist ein sehr gutes Beispiel. Man ist geneigt, ex post zu sagen, daß Leopardi durch seine physische Disposition und das abgelegene Leben zum Dichter geworden ist, den wir kennen. Aber wir wissen nicht, was aus ihm geworden wäre, wenn er in Rom in einer Villa an der Piazza Madama gewohnt hätte. Mit Ihrer Frage wollen Sie aber auf etwas anderes hinaus. Sicherlich kann man sich auch heute keine dichterische Existenz vorstellen, die in allen Belangen der Welt zuständig ist. Das Bild von der Welt, das sich ein Dichter macht, ist nicht aus dem Lärm geboren, sondern aus der Stille. Die Frage ist, wie man zu dieser Stille kommt, nicht jedem ist sie gegeben. Gottfried Benn, der Zeit seines Lebens Geschlechtsteile heilte, zog in Summa summarum nach der ersten Phase seiner Berühmtheit sehr ironisch und zynisch Bilanz über das, was ihm seine Dichterei eingebracht hatte: Es waren Pfennige, ein Stundenlohn von Pfennigen, er mußte weiterhin Geschlechtsteile untersuchen, weil er sonst mit der Poesie gestorben wäre, obwohl er ein prominenter Dichter war. Es gibt andere berühmte Schriftsteller mit bürgerlichen Berufen – Alfred Döblin und Ernst Weiß waren Ärzte – und große Figuren wie Robert Musil, die Zeit ihres Lebens auf Almosen angewiesen waren. Die Frage ist, ob die Gesellschaft generös genug ist sie zu finanzieren. Heute würde ein Musil vielleicht verschiedene Staatsstipendien erhalten und könnte in aller Ruhe den Mann ohne Eigenschaften fertig schreiben. Die Frage nach der Ruhe, der Zurückgezogenheit als Bedingung für ein Werk ist sehr wichtig. Ich bevorzuge die Ruhe, obwohl dies scheinbar im Widerspruch zu meinem Beruf steht. Gerade weil ich sehr viel arbeite, ist diese Ruhe, wenn sie entsteht, so erkämpft, daß sie wirkliche Ruhe ausstrahlt. Hätte ich dagegen alle Zeit der Welt zur Verfügung, würde ich diese Zeit mit allen möglichen Sachen füllen, um sie mir wohnlich zu machen. Aber ich brauche keine wohnliche Zeit.
Salahè: Wie hat sich Ihr Verhältnis zur Sprache entwickelt? Ich meine den Moment, wo aus einer Formel oder dem Drang der Nachahmung auf einmal eine eigene Sprache entsteht.
Krüger: Das ist schwer zu beantworten, weil ich immer gelesen habe und zum Gelesenen in einem mimetischen Verhältnis stand. Als junger Mann las ich nicht nur Poesie, sondern auch Naturkunde, Biologie, Philosophie und anderes. Ich hatte das Glück, Leute zu finden, die mich geleitet haben. Die Mittel haben sich ergeben und ich mußte nur den Körper und den Kopf so austarieren, daß etwas Kreatives entstehen konnte. Es gab aber keine Initialzündung, keinen Stuttgarter Höhenweg wie für Hölderlin oder einen kokelnden Baumstamm wie bei Sartre, sondern einen Übergang. In meiner Entwicklung hat Günther Bruno Fuchs eine wichtige Rolle gespielt, ein heute fast vergessener Berliner Dichter und Holzschneider, aber auch andere Dichter wie die surrealistische Berliner Gruppe um die Zeitschrift Das Lot, die Gerd Henninger herausgab. Ich erinnere gerne an Henninger, weil ich Leuten wie ihm meinen Wunsch verdanke, mimetisch etwas nachzuahmen. Ich sah den feinen Gerd Henninger, ein wirklich armer Dichter, an einem Tisch in einer Kneipe bei mir um die Ecke sitzen, wo er übersetzte, redigierte und schrieb, und ich setzte mich dazu und verspürte den Wunsch, so etwas auch zu machen. Er erklärte mir zum ersten Mal, wer Blanchot, Bataille waren, er las mir René Char vor. So bekam ich ein wenig von diesem poetischen Kosmos mit, die Vorstellung, daß man mit Gedichten etwas Besonderes ausdrücken konnte. Darauf muß man erst mal kommen, denn in der Schule war das vorherrschende Gedicht die Ballade, man war für moderne Dichtung nicht vorbereitet. Und auf einmal kommt Henninger und begeistert mich für René Char. Ich höre noch diese Hypnos-Gedichte, wie er sie mir erklärte – ich las damals kein Französisch –, wie ich eine Form von Verdichtung auf der einen Seite und jenen Blick und Widerblick auf der anderen wahrnahm. Ich sah, wie er durch das Maquis ging, und alle Sinne waren gefordert. Wenn er von den Resistancekämpfern sprach, machte er keinen Roman über die Resistance daraus, sondern kleine, sehr seltsam geformte, in sich noch mal verdichtete Gedichte oder lyrische Prosa, deren Inhalt über jedes interessante Resistance-Buch hinausging.
Salahè: Über dieses mimetische Verfahren haben Sie auch in „Kurz vor dem Gewitter“ geschrieben, „Stets bin ich / auf Wegen gegangen, die andere angelegt haben / jeder Stein eine Erinnerung an frühere Wanderer.“ Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Vorbildern und wo ziehen Sie die Grenze zur eigenen Sprache?
Krüger: Die Wege der Dichter, die man liest und die einen zutiefst treffen – auch in einem ganz unmittelbaren Sinne, denn ich habe viele wie Zbigniew Herbert und Jan Skácel persönlich kennengelernt – geht man sicherlich nach, aber trotz aller mimetischen Anstrengung ist man immer man selber und nicht Tomas Tranströmer, Jan Skácel oder René Char. Im schlimmsten Falle kann die Mimesis zu einem schrecklichen Eklektizismus führen, wenn ich versuchen würde, genauso zu sein wie Hölderlin, und in seinem Versmaß und dem antiken Gestus von meiner Erfahrung zu schreiben. Das klänge sehr komisch. Wir sind zwar mimetische Genies – das Überleben der Gesellschaft basiert auf Mimesis –, in der Literatur kann es jedoch nur bis zu einem gewissen Grade gut sein, diese Übung zu vollziehen. Man merkt es den Texten an, daß sie nachgeschrieben sind – nicht nur nachgegangen, sondern auch nachgeschrieben. Jeder weiß, daß, wenn wir beide im Abstand von einer Stunde den gleichen Weg gehen und danach jeder von uns in getrennten Kabinen einen genauen Bericht davon gibt, sich die Schilderungen erheblich von einander unterscheiden werden. Das ist auch in der Literatur so.
Salahè: Es würde komisch klingen, sagen Sie, wenn man heute wie Hölderlin schreiben würde. Wie ist das Verhältnis von Dichtung und Zeit?
Krüger: Gedichte, die ihre Zeit an der Gurgel packen wollten, sind mit der Zeit vergangen. Ein gutes Beispiel dafür sind Majakowski oder der politische Brecht, während wir den Brecht der Bukower Elegien heute genauso lieben wie wahrscheinlich die kommenden Generationen. Auch dort ist die Zeit anwesend, aber nur indirekt. Die Literatur schreibt hier kein Gedicht, keine Ekloge oder Elegie über die Zeit, die gerade stattfindet, läßt sie aber in den Text einfließen. Es entsteht etwas, das zugleich in der Zeit und aus der Zeit ist, das in zwei Welten lebt. Gustafsson hat dies einmal unnachahmlich in einem Gedicht über Taucherenten ausgedrückt, von denen man nicht weiß, welchem Element sie angehören, da sie sowohl über als auch unter Wasser zu Hause sind. Die Zeit ist anwesend in der Sprache, im Sprachgebrauch, in der Form und gleichzeitig abwesend, weil sie nicht für eine bestimmte Sache Propaganda macht. Solche Gedichte bleiben von Zeitumständen unaffiziert, während die wirklich politischen Gedichte auch meiner Generation, etwa die von Erich Fried, langweilig geworden sind, leer, da der Skandal der Zeit, den sie beschrieben, vergangen ist. Frieds Liebesgedichte dagegen werden immer noch viel gelesen. Der Schriftsteller, der Poesie zum Sprachrohr einer Ideologie macht und ihr damit zum Sieg verhelfen will, verkennt, daß man mit jeder politischen Streitschrift besser für eine Ideologie kämpft als mit Gedichten. Diese Art von Dichtung ist eigentlich ein Verrat sowohl an der Politik, da es wirksamere Mittel gibt, als auch an der Poesie, die zum reinen Instrument degradiert wird.
Salahè: Man sagt, daß große Dichter, im Italienischen etwa Ungaretti und Montale, die Seelenlage ihrer Zeit zum Ausdruck gebracht haben, einer Zeit, in der aber konventionellere Dichter wie Carducci und D’Annunzio gefeiert wurden. Wie erklärt sich dieser Widerspruch?
Krüger: Montale, dessen späte Gedichte ich besonders liebe, hat sich in seinem poetischen Leben immer mehr von der Tradition frei gemacht und eine Stimme entwickelt, die von den Dingen und den Blicken ausging. Es war der Blick aus dem Fenster über die Klippe auf das Meer, es war immer noch ein – wenn auch befragter – metaphysischer Himmel. Er kam aus einer tiefen humanistischen Tradition, hat aber in seiner späten Poesie nur aus sich selber geschrieben. Dieses Phänomen läßt sich bei den Dichtern, von denen ich sprach, beobachten, so auch bei Tomas Tranströmer, der als Psychologe in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche arbeitete, dessen Poesie aber keineswegs mit dieser Beschäftigung zu identifizieren wäre. Oder nehmen Sie Skácel, der den ganzen Terror von der deutschen Besatzung und der russischen Besetzung bis 1968 erlebte. Er hat diese Welt in sein Gedicht nicht einfließen lassen, sondern sein Gedicht als Gegenwelt entworfen. Skácel war ein vollkommen politischer Mensch, aber er wäre nie auf den Gedanken gekommen, ein politisches Gedicht zu schreiben, sondern er hat über den Geschmack von Beeren geredet, die er in seiner Jugend gegessen hatte. Das ist der Punkt: Carducci und auch D’Annunzio brauchten das große Dekor, um ihr dichterisches Potential anzutreiben. Skácel, Char, Tranströmer brauchten das nicht, für sie hatten die rhetorische Tradition und die geschichtliche Welt mit dem Drama des kleinen Gedichts auf dem Papier nichts zu tun. Vielleicht ist es nur mein Geschmack, daß ich diese Dichter bevorzuge, weil sie mir am nächsten stehen. Sie erwähnten auch Ungaretti, dessen Gedichte aus dem Ersten Weltkrieg ohne seine Erfahrung als Soldat nicht denkbar sind. Aber heute sprechen sie zu uns nicht als Gedichte über den Ersten Weltkrieg, sondern sie sprechen eine ganz andere Schicht in uns an. Das macht, glaube ich, die großen Gedichte aus.
Salahè: Sollte man in der Poesie außer der Zeit auch die Persönlichkeit des Autors abstrahieren? Eliot behauptete, daß „Dichtung nicht der Ausdruck der Persönlichkeit ist, sondern ihre Aufhebung“.
Krüger: Eine alte, viel diskutierte Frage: Gibt man sich, wenn man ein Gedicht schreibt, als Person auf? Wem gehört das Gedicht und ist ein Körper notwendig, um es hervorzubringen? Wer schreibt? Die Sprache? Es gibt Theorien, wonach die Sprache sich einen Körper sucht, um einen Text auszubrüten, und ihn danach verläßt. Der Körper verfällt, während der Text bestehen bleibt. Bei lebenden Personen stellt der Körper mit seiner Vorstellung von Rhythmus, von Bildern, mit seiner Produktion von Wortzusammensetzungen, mit seinem gesamten physischen Apparat einen fundamentalen Resonanzboden der dichterischen Kreation dar. Denken wir an die Geschichte der Literatur und der Genußmittel – wie viel Alkohol und Haschisch verbraucht wurde, um Bücher hervorzubringen. Es gibt sehr unterschiedliche Anregungsmöglichkeiten: Der eine, Schiller, brauchte, wie Goethe beschrieben hat, faule Äpfel, der nächste nimmt Marihuana – alles geht in den Körper, der dann als Produzent tätig werden soll. Andere müssen wiederum lange Spaziergänge machen – ich kenne Schriftsteller, die nicht schreiben können, wenn sie nicht vorher eineinhalb Stunden gegangen sind. Wer das Glück hat am See zu wohnen, geht vielleicht morgens eine Stunde schwimmen, weil er dadurch rhythmische Eingaben erhält, die er sofort literarisch umsetzen kann. Pavese war ein großer Spaziergänger und mußte durch die Turiner Weinberge gehen, um in einen bestimmten Rhythmus zu kommen. Über solche weitreichenden Fragen wird seltsamerweise in der modernen Poetologie selten nachgedacht. Es gibt unzählige Bücher, Aufsätze darüber, ob die Sprache selber spricht, ob man nur der Techniker, der Ingenieur ist, aber über den Körper als Produzenten gibt es sehr wenige Untersuchungen, obwohl jeder, der mit Dichtern befreundet ist, weiß, wie wichtig dies ist.
Salahè: Woran machen Dichter fest, dass Ihre Texte abgeschlossen, reif für die Publikation sind? Der mexikanische Kritiker Alfonso Reyes sagte, daß „man veröffentlicht, um mit dem Korrigieren aufzuhören“.
Krüger: Ich denke, daß es einen inneren Rhythmus gibt, der sich nicht forcieren läßt. Man kann einen Gedichtband nicht auf einen Termin hin schreiben. An einem Artikel, der um vier Uhr in der Druckerei sein muß, kann man bis fünf vor vier arbeiten, man kann sogar einen Roman, wenn man ihn nicht mehr sehen kann, irgendwie abschließen. Aber einen Gedichtband kann man nicht planen, es gibt eine innere Uhr, die den Zeitpunkt seiner Reife angibt. Wenn man mit Autoren arbeitet, sieht man, wie problematisch das ist. Bietet man beispielsweise die Publikation eines Gedichtbands in einem gewissen Format, das neunundsechzig Seiten nicht überschreiten soll, an, fangen fürchterliche Diskussionen an. Es gibt auch Tricks, indem man etwa verschiedene Abteilungen macht, und sonst alle möglichen Selbstüberlistungen, aber der eigentliche Zeittakter ist ein innerer Rhythmus, der einem sagt, daß ein Buch vollendet ist. Anders als bei anderen literarischen oder journalistischen Gattungen, die auf ein Ziel hin geschrieben werden, kommt es bei einem Gedichtband darauf an, daß die Texte sich so zusammenlegen, daß sie eine Form ergeben. Oft sind es Gedichte, die über Jahre entstanden sind und zeitlich wenig miteinander zu tun haben, und gerade dann muß das innere Gefühl noch stärker ausgeprägt sein. Der Leser merkt sofort, wenn etwas nicht stimmt, wenn etwas beigemengt wurde, um den Band dicker zu machen. Die Engländer wenden Bezeichnungen wie The Collected Shorter Poems, The Collected Longer Poems, The Collected Nature Poems und The Collected Love Poems an – das sind aber alles Tricks. Der neue Band muß in sich stimmig sein – was die Kritik sagt, ist wieder etwas anderes.
Salahè: Sie haben in Reginapoly in Ihrem Nachgedicht geschrieben „ Vieles reimt sich wieder, was uns vor Jahren wie ein Versprecher vorkam“. Wie blicken Sie auf Ihre Gedichte zurück? Reimen Sie sich wieder oder kommen Sie Ihnen manchmal wie Versprecher vor, die Sie ändern möchten?
Krüger: Es gibt Temperamente, die in den circa vierzig Jahren, in denen man schriftstellerisch produktiv sein kann, immer nur ein Gedicht schreiben wollen und daran rumfeilen und tausend Fassungen anfertigen und unzählige Titel entwerfen und andere Enden und andere Mittelteile. Es gibt auch Menschen wie ich, die glücklich sind, wenn sie eine Sache hinter sich bringen. Es käme mir sonst wie der Versuch vor, an der eigenen Vergangenheit zu feilen, sie ändern zu wollen. Ich habe mich stets als einen Menschen betrachtet, der über essentielle Dinge verfügt, aber der Rest war bei mir immer en mouvement. Das mag komisch klingen für jemand, der Zeit seines Lebens in Büros verbracht hat, aber gerade deshalb habe ich die Literatur gewählt, weil die Literatur selber mich in eine Bewegung versetzt. Deswegen fällt es mir schwer, das Alte noch mal zu bearbeiten. Es gibt Stücke, die mich in meiner Jugend sehr beeindruckten und mir heute unerträglich vorkommen, Andorra von Frisch beispielsweise. Doch ich bin mir sicher, daß Frisch sein Stück nicht umschreiben würde, weil sich die Zeiten geändert haben, sondern dafür andere Bücher schreiben würde, wie er es mit Montauk oder Der Mensch erscheint im Holozän getan hat. Wenn man sich selber als einen Text nimmt, dann ist dieser Text gleichermaßen der Zeit ausgeliefert, man hat eine Jugend, man hat eine Zeit des Sammelns und dann hat man noch etwas Zeit, um sich auf das Nichts vorzubereiten.
Salahè: Sie sagten „der Dichter als Text“, ein Text, der sich sicherlich auch durch Übersetzung in andere verwandelt. Sie haben selber übersetzt und haben viel in Ihrer Rolle als Herausgeber und Verleger mit Übersetzung zu tun. Wie wichtig ist für Dichter das Übersetzen?
Krüger: Jeder, der Gedichte schreibt, sollte auch Gedichte übersetzen, egal, wie viel er von der Sprache versteht. Es ist ein großes Glück, morgens am Küchentisch zu sitzen, ein paar Gedichte zu lesen und zu versuchen, eine deutsche Entsprechung zu finden. Man braucht viel Konzentration, um eine Entsprechung für etwas zu erfinden, das schon existiert. Ich wünschte jedem Menschen, daß er jeden Morgen ein Gedicht übersetzt, bevor er zur Arbeit geht, dann hätte er – auch wenn er nicht alles versteht – schon eine enorme geistige Leistung vollbracht. Denn der Versuch, von einer Sprache in die andere etwas zu übersetzen, ein inhaltliches, ein klangliches, ein rhythmisches Gebilde, ist nichts anderes als die Selbsterfindung des Menschen. Unser Vorstellungsvermögen ist nicht mehr als die tägliche Übersetzung dieser Elemente in unser Idiom, alles andere wäre schnödeste Prosa und Macht. Denn hier habe ich nicht Macht, ich muß auf den anderen Rücksicht nehmen, ich muß ihn beschützen, ich darf den Text nicht verletzen. Gedichte zu übersetzen ist eine Einübung in eine humane Lebensweise, wie ich sie besser nicht denken kann. Es sollte in der Schule ein Fach „Übersetzen“ geben, dann hätten wir weniger Probleme mit der Fremdenfeindlichkeit. Man würde die Sprache lernen, die Höflichkeit im Umgang mit dem Fremden, etwas über den Rhythmus, den alle unbewußt nachmachen, wenn sie tanzen oder gehen. In meiner Jugend wurde in der Schule aus toten Sprachen übersetzt, aus dem Lateinischen und dem Griechischen, und es wäre undenkbar gewesen, im Englischunterricht ein Gedicht von T.S. Eliot oder von Bob Dylan zu übertragen. Wie viel hätten wir daraus lernen können, daß aus einem Gedicht von Bob Dylan, der damals unser Held war, dreißig verschiedene Fassungen entstanden wären!
Salahè: In seinem Zeugnis der Poesie fragt sich Miłosz, ob der Ton der Hoffnungslosigkeit, der die Dichtung des letzten Jahrhunderts charakterisierte, nicht zu jenen Eigenschaften gehört, „die später einmal als der für alle Dichter verbindliche Firnis eines bestimmten Epochenstils anerkannt werden“. Wie sieht für Sie die Poesie des neuen Jahrhunderts aus?
Krüger: Die Dichtung wird sich ändern, in welche Richtung, kann ich nicht sagen. Die modernen Tendenzen – von Hip-Hop bis zu den gesprochenen Kap-Dichtern – zeigen bereits neue Wege, die nichts mehr vom melancholischen Firnis haben. Diese Literatur ist im Gegenteil aggressiv, weil sie versucht sich zu wehren, durch eine Selbstrhythmisierung des Körpers eine Abwehrkraft zu entwickeln, die sich in ihrer sprudelnden Sprache entlädt. Aus der ganzen Postmelancholie wird sich, glaube ich, irgendwann eine Pro-Bewegung entwickeln, und zwar aus Selbstschutz. Wir sind Kinder des 20. Jahrhunderts, haben noch den dichten Schatten der Ideologien mitbekommen, wir sind in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs geboren, in eine Welt, die auch durch Mimesis über den Schrecken nachgedacht hat. Und da es keine Lösung gab für den Schrecken, ist dieser melancholische Ton entstanden, der nichts mit der Sterblichkeit und dem subjektiven Verhältnis zur Welt zu tun hat, sondern mit der Zeit. Man konnte Zeit nicht anders spüren als entsetzlich. Aber es wird Generationen geben, die sich von dieser Melancholie verabschieden, die auf die Feier, die Ekstase, die Überschreitung nicht verzichten. Und wenn man mit der Literatur das Leid überschreiten kann, um ein wie auch immer temporäres Glück zu finden, dann wird es vielleicht eine Literatur geben, die viel naiver mit dem Glück zu tun hat.
Neue Rundschau, Heft 4, 2005
Welche Poeme haben das Leben und Schreiben von Karl Mickel und Volker Braun in der DDR und Michael Krüger in der BRD geprägt? Darüber diskutierten die drei Lyriker und Essayisten 1993.
Das Werk: Michael Krüger am 14.6.2004 im Literarischen Colloquium Berlin
Frank Wierke: Verabredungen mit einem Dichter – Michael Krüger
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Das unbändige Leben der Agaven
Der Tagesspiegel, 9.12.2013
Volker Isfort: Er wird noch gebraucht
Abendzeitung München, 8.12.2013
Thomas Steinfeld: Herr K. tritt ab
Süddeutsche Zeitung, 9.12.2013
Charles Simic: Der Regenmantelmann
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Norbert Gstrein: Der leere Raum
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Cees Nooteboom: Der andere Atem
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Peter von Matt: Der Freund auf der Kommandobrücke
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Hans-Dieter Schütt: Warum fallen Sterne nicht herab
neues deutschland, 9.12.2013
Mara Delius: Nach draußen, hinein ins Buch
Die Welt, 9.12.2013
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Britta Schultejans: Michael Krüger wird 75
Abendzeitung, 7.12.2018
Georg Reuchlein: Michael Krüger (75)
BuchMarkt, 9.12.2018
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Gerrit Bartels Interview mit Michael Krüger: „Gott ist ein Melancholiker“
Der Tagesspiegel, 7.12.2023
Willi Winkler Interview mit Michael Krüger: „Ich habe mich der Literatur höflich genähert“
Süddeutsche Zeitung, 7.12.2023
Arno Widmann: Der virtuose Gesang und der Schrei
Frankfurter Rundschau, 9.12.2023
Andrea Köhler: Kaum einer hat so viele Literaturnobelpreisträger in seinem Verlag versammelt wie Michael Krüger
Neue Zürcher Zeitung, 8.12.2023
Hannes Hintermeier: Schwimmer im Meer der Gedichte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.12.2023
Hans-Dieter Schütt: Wie kommen Sterne an den Himmel?
nd, 8.12.2023
Leander Berger: Lesen als Lebensmittel
Badische Zeitung, 9.12.2023
Quh: Freund der Ziegen
quh-berg.de, 9.12.2023
Martin Schult: „Danke“
Börsenblatt, 8.12.2023
Volker Weidermann: Küsse, Nasenküsse, Ringkämpfe. Abschiedsfest für Michael Krüger.
Ein Abend für Michael Krüger. Michael Krüger ist eine Legende des Literaturbetriebs. Am 16.1.2014 sprach er in der Literaturwerkstatt Berlin mit Harald Hartung über seine Arbeit als Verleger, Herausgeber, Autor und Übersetzer.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Michael Krüger – Lebenselixier Literatur im Gespräch mit Norbert Bischofberger, SRF 22.9.2013.
Keine Antworten : Michael Krüger: Reginapoly”
Trackbacks/Pingbacks
- Michael Krüger: Reginapoly - […] Klick voraus […]


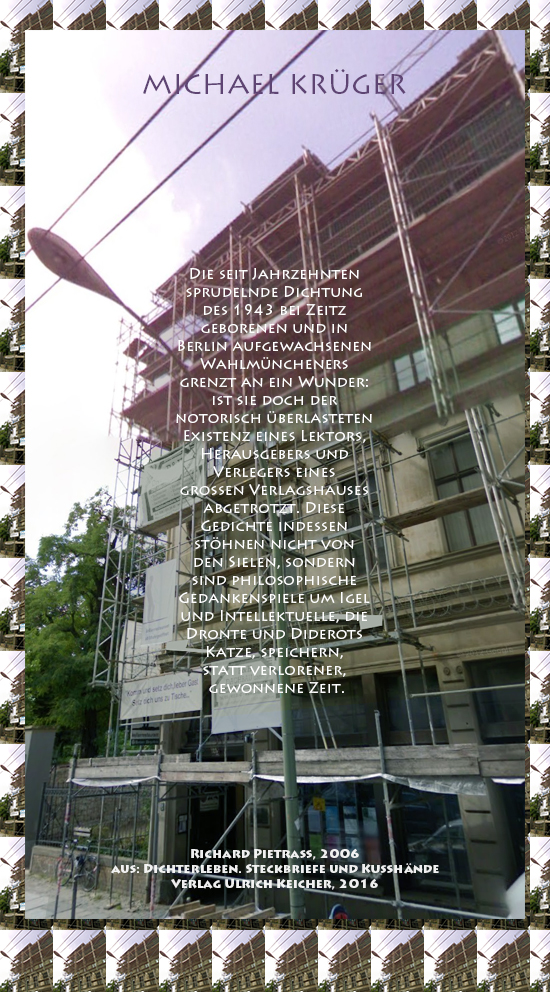












Schreibe einen Kommentar