Wolfgang Hilbig: Das Meer in Sachsen
das glück zahlt summen für hohngelächter
seiner spitzel einzige pflicht ist es zu lachen
wenn der empörte daumen der verächter
von oben befehl gibt schluß zu machen
dann senkt der ritter auf dem stein am strand
das gesicht in die hände: er scheint durchschaut
bis auf den schatten der den stein umkreist
der sonne hingeneigt doch ihrem strahlen abgewandt
(als zöge licht nicht auch die schattenhaut
ab von der niedertracht die sich als glück verheißt)
in eile ist das glück es scheint die zeit
ihm jederzeit zu winken: bist du dabei so eile mit
und sei bereit
aaaaaaaaaaaaman wird dich schminken
wenn dir das joch aus den wangen tritt.
Nachwort
Von der Poesie leben oder für die Poesie, für die Literatur leben – beides ist riskant. Im ersteren Fall für die Poesie; in der einstigen DDR zog ideologisches Wohlverhalten materielle Vergünstigungen und allerhand gesellschaftliche Privilegien nach sich. Oft war dann auch die Literatur danach: provinziell, kompromißbereit, klischeehaft, sprachlich dröge bis bieder; im besten Fall wurden dialektische oder erzähl-strategische Turnübungen veranstaltet; wer Formen fand, den inneren und äußeren Zensor zu täuschen, konnte mit der besonderen Neugier der Leser in Ost und West rechnen. Immerhin: die Lyrik der DDR hat sich davor noch am meisten bewahren können. Sie wird die Gattung sein, von der wesentlich Originäres bleibt. Im Westen hingegen hieß von der Literatur leben den Marktvorteil suchen, die Trends finden oder sie eben mitbewirken, mitschaffen, Aufmerksamkeit herzustellen durch außerliterarische Mittel, und sei es – wie einmal beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb –, daß man mit einer angedeuteten Selbstverstümmelung, einem Rasierklingenschnitt auf der Stirn, – das Interesse auf die Literatur, nein, auf den Dichter zog.
„Wer von der Poesie lebt, ist verloren.“ Ein romantisches, ein in seiner umfassenden Bedeutung realistisches Wort von Clemens Brentano. Wolfgang Hilbig, der 1941 geborene sächsische Arbeitersohn, hat so gedacht, gelebt, gedichtet, nämlich rücksichtslos gegen sich selbst für die Poesie. Er hat sein Leben auf nichts anderes gestellt als auf die Erschaffung seiner Dichtung. Er ist ein lyrischer Anachoret in der Ödnis einer „Literaturgesellschaft“ gewesen, die aus staatsmonopolistischen Gründen immer bestimmen wollte, was denn die „richtige“ Literatur sei. Um schreiben zu können, mußte Hilbig ein Doppelleben führen. Heimlich las und schrieb er zu Hause in der Bergarbeiterfamilie des polnischen Großvaters, der nie das Alphabet gelernt hatte, und darum mißtrauisch auf alle Schrift war, sie für schwarze Magie hielt. Hilbig hatte nie ein Arbeitszimmer und keine Freizeit als Dichter; so schrieb er heimlich auch während seiner zehnjährigen Tätigkeit als Heizer in seiner Geburtsstadt Meuselwitz, nahe Leipzig. Er schuftete vor den Öfen für zwei, denn er mußte den Acht-Stunden-Arbeitstag auch für seine Lyrik nutzen, für eine Poesie, für die er in der DDR keine Chance sah. In den Zirkeln schreibender Arbeiter (man hatte ihn anfänglich zu den Eisenbahnern „delegiert“) hat man ihn nie verstanden, und auch sonst hatte er keine mächtigen Verbündeten unter etablierten Schriftstellern, die ihm hätten helfen können. Seine Freunde, junge Leipziger Autoren wie Siegmar Faust und Gert Neumann, waren damals als Schriftsteller rechtlos, weil sie nicht publizieren durften wie er, und nur durch eine Publikation die Legitimation bekommen hätten, Schriftsteller, Dichter der DDR zu sein. Ein Teufelskreis. Erst spät, als Franz Fühmann von der ersten Publikation bei S. Fischer in Frankfurt/M. erfuhr, besorgte er Hilbig eine Steuernummer, und so wurde er wenigstens durchs Finanzamt als Schriftsteller in der DDR anerkannt.
Kurz davor wollte ihn schon die Stasi als bedeutenden Autor anerkennen, indem sie ihn acht Wochen ins Gefängnis sperrte, um ihn für ihre Dienste gefügig zu machen. Aber Hilbig hat nie mit „der Macht“ paktiert, er hat sie ignoriert, als hätte sie nichts zu sagen. Jeder Rückhalt in der Gesellschaft (etwa auch durch den Schriftstellerverband, der so viele gefällige Textverfasser zu seinen Mitgliedern zählte) war Hilbig versagt.
Das Paradoxe: Der Dichter Hilbig war einer der ganz wenigen kompromißlosen Autoren der DDR, der in ihr lebte und in ihr schrieb, aber nie Schriftsteller der DDR werden konnte. Zu spät hat dann der Reclam Verlag in Leipzig auf Betreiben Fühmanns einige vorher im Westen gedruckte Gedichte publiziert. Dessen sollte man sich heute erinnern, ob all des Wehgeschreies um verlorene Positionen der privilegierten DDR-Autoren.
O warten
welch traurige Karriere
lautete eine Verszeile – das war des Dichters Hilbig lange währendes Schicksal. Er sagte sich, ,mach deine Arbeit, wenn du schon nicht publizieren kannst; und schreib, so weit es geht für dich.‘ Wie dieses Leben zeitweise aussah, hat der Freund Siegmar Faust einmal beschrieben:
Wolfgang Hilbig war… nahe daran zu verzweifeln, kaputt zu gehen, sich totzusaufen. Über acht Stunden führte er täglich eine Montagetätigkeit in einer Braunkohletagebau-Landschaft aus, die ihn, wie wir aus einigen seiner Gedichte erfahren können, nicht nur physisch ermüdete. Seine Arbeitskollegen konnten mit seinen Gedichten absolut nichts anfangen, dennoch teilte er fast seine gesamte Zeit mit ihnen, tags auf der Arbeit, nachts im Wohnwagen…
Zur Leipziger Frühjahrsmesse 1969 konnte ich Wolfgang Hilbig, der gerade die Arbeitsstelle wechseln wollte, dazu überreden, mit zu mir nach Heidenau bei Dresden zu ziehen. Ich kam mir unheimlich edel und großzügig vor. Ich bot ihm mein sechs Quadratmeter kleines Arbeitszimmer unbefristet zum Wohnen bei freier Kost an. Meine damalige Frau verdiente ohnehin für unsere fünfköpfige Familie als Küchenhilfe unser Kostgeld, da kam es auf einen Esser mehr oder weniger nicht an. Ein paar Tage waren wir ausgesprochen produktiv und zufrieden, wenn nicht gar glücklich. Wolfgang versuchte sich sogar in Prosa… Doch es ging nicht allzu lange gut. Als das Taschengeld knapp wurde und somit auch für Wolfgang der Tabak und der nötige Alkohol, wurde es kritisch… Hinzu kamen andere Schwierigkeiten. Erst später merkte ich, daß es halt nicht genügt, Brot, Bier und Räumlichkeiten zu teilen…
Hilbig hat vor allem das Gedichteschreiben als die ihm gemäße Existenzform gewählt; auch als Abwehr gegen das gewöhnliche Leben in der DDR, was ja wiederum fast ein romantischer Zug ist. Fällt nun diese innere Notwendigkeit weg, die Lyrik als „Waffe“ gegen die Unerträglichkeit des Daseins zu gebrauchen, versiegt auch die Produktion von Gedichten. Jedenfalls schreibt Hilbig, seit er in der Bundesrepublik lebt, also seit gut zehn Jahren, kaum noch Lyrik. Um so überraschender das mehrseitige Gedicht „prosa meiner heimatstraße“, das zwischen 1988 und 1990 entstand (veröffentlicht Anfang 1990 in Heft 2 der neuerstandenen Neuen Rundschau), das wir hier aufgenommen haben, ein eindrucksvolles Langzeilenpoem, in dem Hilbig seine zentralen Themen wieder aufnimmt: Herkunft, Heimat, Erinnerung, Sprache – sie werden lyrisch reflektiert, evoziert –, in einem manchmal an Hölderlinsche Hymnen erinnernden Rhythmenfluß. Immer wieder ist gefragt worden, wie kommt einer aus nichtbürgerlichem Milieu dazu, ein Lyriker der Hochsprache in der modernen europäischen Dichtungstradition zu werden? Den deutschen Vater aus dem Eulengebirge lernt der Sohn nie kennen, weil er in Stalingrad fällt; der Großvater spricht nur gebrochen Deutsch, und die Mutter, Verkäuferin im „Konsum“, schämt sich, „Polackin“ zu sein und liest darum wohl ihr Leben lang immer wieder nur ein Werk: Goethes Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre. Das Zusammentreffen fremder Völker, die Mutation der Gene allein, reicht da kaum als Erklärung. Eher dieses sich gegen die Welt stellen, sich über die Niederungen der Herkunft und des Alltags zu erheben, war Hilbigs uranfänglicher Antrieb. Vor allem die französischen Symbolisten und die deutschen Romantiker werden seine Vorbilder. Nicht, daß er deren Sprache einfach ungeprüft übernommen hätte. Er erneuert vielmehr noch einmal die Hochsprache der Poesie, indem er seine proletarischen Lebenserfahrungen und die seiner Arbeitswelt in dieser auszudrücken versucht. Eine wahrhaft tollkühne Herausforderung.
Nur so ist dann Franz Fühmanns Aufforderung an Hilbig zu verstehen, er solle doch Mallarmé neu übersetzen. Hier allerdings erlag Fühmann der Faszination für Hilbigs Dichtung: So wenig wie Hilbig Arbeiterdichtung und Reportagen schreiben konnte („Da müßte ich mir ja die Klischees aus den Fingern saugen“), hätte er wahrscheinlich für Mallarmé eine neue poetische Sprache gefunden: Hilbigs Dichtung braucht den autothematischen Antrieb, braucht die unmittelbaren Lebensumstände. Und – er kennt sich in der Weltpoesie aus, er las früh Robert Creeley und H.M. Enzensberger, er kennt die Spanier Cernuda und Alberti, Lateinamerikaner, Neruda, Octavio Paz, Jaime Sabines und andere. Er ist also auch ein großer Lyrikleser, was man von den westdeutschen Poeten nicht immer behaupten kann.
Hilbig, so sagte er einmal, wäre gern ein Reiseschriftsteller geworden. Er ist es mitnichten. Auch eine lukrative Gastdozentur als „writer in residence“ an der Austin University in Texas hat er vorerst zurückgestellt. Es ist zuviel los jetzt in Deutschland, meint er. Sachsen, die Umbruchzeit als innere Welt, sie bleiben seine Realität. Und:
Ich muß meine Texte aussitzen.
Im Kesselhaus in Meuselwitz hat er zehn Jahre lang eine geradezu irrwitzige literarische Vorratswirtschaft betrieben; das heißt, fast alle seit 1979 dann in der Bundesrepublik veröffentlichten Bücher, die beiden Lyrikbände abwesenheit (1979) und die versprengung (1986), drei Prosabände und der Roman Eine Übertragung sind im wesentlichen dort entstanden.
Und von diesen sächsischen Substanzen zehrt er bis heute, wenn auch hin und wieder jetzt Prosatexte und ab und zu ein Gedicht in der bundesrepublikanischen Zeit entstehen.
Wenn man Schriftsteller ist, wird alles symbolisch.
Bundesrepublik hat er bis jetzt „noch nicht groß gebraucht“, es ist „das Land, das mich am Leben erhält“. Denn hier ist er nun endlich und ausschließlich Schriftsteller. Er hält die „Verwertungssituation, in der der Autor sich im Westen befindet, für realistisch“ und „gewissermaßen für ehrlich“.
Wenn die Marxisten immer von gesellschaftlichen Bedürfnissen geredet haben, so muß hier jeder Autor selber, oft auch schmerzlich herausfinden, ob er ein solches Bedürfnis tatsächlich bedienen kann. (Frankfurter Rundschau, 20. Juni 1990.)
In der DDR hatte er als Heizer ein gutes Auskommen. Obwohl er zum Beispiel seit sechs Jahren seinen Wohnsitz in Nürnberg hat (und seit 1980 lebte er fast immer in der Bundesrepublik), kennt er die Stadt nicht; denn er arbeitet nachts, wenn die Programme enden, und schläft tagsüber; so ist er eigentlich vom Leben „hierzulande“ ausgeschlossen. Hilbig, Ingeborg-Bachmann-Preisträger von 1989, ist seither für Lesungen allerdings ein gefragter Poet; aber diese nehmen ihm immer wieder die Zeit, in seinen „wüsten Bergen von Zetteln und Manuskripten und Blättern etwas zu finden, was mir zusagt“.
Lebte er in der DDR konfliktreich, weil er die Doppelexistenz Arbeiter und Schriftsteller durchhalten mußte – um seiner Poesie willen, kommt er im Westen bald zu der Einsicht, zu der die meisten ehemaligen DDR-Bürger erst spät oder nur selten kommen:
Man kann überhaupt für das wenigste, was einem widerfährt, ein System verantwortlich machen. Man ist es selber, der nicht funktioniert. Das war so eine Grunderkenntnis, die ich hatte, nach kurzer Zeit schon. Und das hat die Lyrik erst einmal lahmgelegt.
In der DDR hingegen kam der einzelne immer wieder in die Lage, für alles, was nicht funktionierte, das System, den Staat, die Moral verantwortlich zu machen.
Für Hilbig war nun die Lyrik ein unmittelbares Instrument, sich gegen die Fremdbestimmung, gegen das Über-Ich zu wehren. Denn er sagte sich, die Biographie ist das, was der Staat sieht, beschreibt, in Kaderakten und Dokumenten festhält; dieses Ich ist unfrei – wie Hilbigs proletarisches Leben, das mehr vorgeformt, vorgeprägt ist als ein bürgerliches insgesamt. Und von daher beginnt er, ein anderes Ich zu erschaffen, ein literarisches Ich, ein erfundenes Ich, das stärker ist, das nun dominant ein fiktives literarisches Ich ist, Hilbigs Protagonist in allen Texten, sein alter ego?
Nun beginnt seine fiktive Autobiographie, so könnte man sein ganzes Werk nennen, der Versuch einer Neuschöpfung eines Ich. Das schöpferische Moment der Selbstzeugung dieses Ich entfernt sich vom biographischen Ich und ist doch noch irgendwann in Augenblicken wieder das Hilbigsche Ich. Aus diesem Spannungsprozeß lebt seine Dichtung.
Von Peter Rühmkorf stammt die einmal aufgestellte Forderung, daß für die Lyrik heute entscheidend sei, „unverstellt Auskunft über die Verfassung des Ich“ zu geben. Hilbig sagt nichts anderes, wenn er anführt, daß man die „Differenz zwischen der Möglichkeit, sich überhaupt zu artikulieren, und dem, was man artikulieren will, möglichst kleinhalten oder überbrücken muß“.
Insofern läßt sich sagen, daß jedes Buch sich wie die Absplitterung von einem Ich liest und doch erst dessen Erschaffung ist. Jedes Gedicht, jeder Prosatext fragt mit immer größerer Verletztheit: ,Woher komme ich‘, ,Wer bin ich?‘ Das ist natürlich nicht mehr Kants „Ankunftsliteratur“ von vor 20, 25 Jahren, als „Aulareden“ „quasi“-ironischen Stils für ihren frischen Ton öffentlich Beifall bekamen. Hilbig hält „Kellerreden“, spricht von einem Ich, das „unterhalb des Lebens“ angesiedelt ist. Körperlich spürbar ist das an der Gesellschaft leidende Subjekt, das daran gehindert wird, seine Identität zu finden. Der DDR-Schriftsteller konnte an der archaischen Gesellschaftsstruktur des klaren Oben und Unten sein Spannungsverhältnis viel deutlicher machen als der bundesrepublikanische an der seinen. Hilbigs Arbeiter ist nicht unter die Intellektuellen gefallen, wie noch der in Gerhard Zwerenz’ Roman, der sich an „Kopf und Bauch“ orientiert. Da Hilbig das Ich zur einzigen „Instanz“ macht, die subjektiv und moralisch zählt, geraten umgekehrt die öffentlichen Instanzen, die seinem Lebensentwurf im Wege stehen, ins Zwielicht.
Überall in seiner Poesie stößt man auf autobiographische Splitter – die Anlässe, die ihn immer wieder zur Dichtung getrieben haben; etwa in dem großen eindringlichen Gedicht „die gewichte“:
die gewichte zum pflaumenabwiegen
liegen auf ihrem platz in der küche
zylindrische schwarze eiserne gewichte
als in galizien das währungssystem eingeführt wurde
kam mein großvater des lesens und schreibens unkundig
und verzweifelt (so viele hundert werst entfernt von wien
warfen die zahlen mystische schatten und säten nichts aus)
nach europa trug den honigduftenden samen
für meine mutter meine onkel tanten vorbei an den habsburgen
…
meine mutter unter allen umständen wollte
deutsch werden doch war ihr haar von der farbe des honigs
der aus den früchten floß. ich habe von den deutschen
das lesen und schreiben von meinem großvater die art
zu sehen scharf wie den deutschen weibern das rohsa fleisch
durch die haut scheint und die lust
den honig in der stille zu riechen…
Hilbigs lyrisches Subjekt ist mit tausend Fäden mit der Realität verknüpft; im Gedicht „bewußtsein“ heißt es zum Beispiel:
im namen meiner haut
im namen meiner machart
im namen dieses landes
wo die sorge sich sorglos mästet
im namen welches zerrissnen
namens den sich heimlich
die liebespaare zuflüstern
im namen welcher unerlaubten
schmerzen
aaaaaaaadie verwirrung
in worte zu kleiden
aaaaaaaaaaaaaaahab ich
das schreiende amt
aaaaaaaaaaaaaaaübernommen
Aus einer tiefen Entfremdung findet Hilbigs Lyrik Ausdruck in vielen unauslöschlichen Bildern:
plötzlich bin ich der unverhoffte hund der seinen schwanz
auf meine schultern schlägt und mir ins ohr raunt: faß ihn faß ihn
beiß ihn ins bein deinen bruder und piß
an diesen baum dort dem sollen die drosseln
zu durstigem holz
verdorrren.
Vor allem auch die langen Prosapoeme in freien Rhythmen wie „ophelia“ oder „das meer in sachsen“ sind einzigartige lyrische Gebilde in der neueren deutschen Lyrik; sie bewahren einen hochpoetischen Gestus, obwohl sie von ganz kruden, aktuellen Dingen handeln: Ophelia in einer von der Zivilisation zerstörten Natur – und jene kolossale Vision, in der sich Geschichte und Landschaft Sachsens mit Hilbigs Biographie verschlingt, das eine im anderen zu ertrinken droht in einem sächsischen Meer.
Die Phantasie und die Sprache Hilbigs haben jene vitale, suggestive Kraft, mit der die Düsternis auch eines Kesselhauses überwunden wird wie im Gedicht „episode“: der grüne Fasan auf dem Brikettberg ist nicht bloß ein Bild der Imagination, er wird jenseits des lyrischen Subjekts real für den Heizer Hilbig:
konversation fand nicht statt
ich bewegte mich und er flog davon durch die offene tür
doch von weit her den geruch der sonne den duft
seines farbigen gelächters ließ er hier in der nacht
und ich verwarf alle mühe das leben mythisch zu sehen –
und als das kausale grinsen meines kopfes
von energie und frost gefressen in der nacht verschwand
glaubte ich nicht mehr an den untergang
der wahrnehmungen in der finsternis.
Das ist gewiß nicht die Lyrik eines Arbeiterschriftstellers; und darum hat man Hilbig auch nicht verstanden. Und trotz der Pressionen durch eine autoritäre Grammatik („Der spricht unsere Sprache nicht“) hat das bei Hilbig nie wie bei etlichen DDR-Autoren zu einer halbseitigen Lähmung geführt. In seinem Prosatext „Einfriedung“ spricht er einmal davon:
Ich glaubte zuletzt, die Zerstörung des scheinbaren Zweckes der Grammatik – dessen Gewalt in meinem Schädel wuchs, wie ein Tumor in einer schmerzhaften, bewußtseinstrübenden Form – sei identisch mit der Zerstörung meines Willens zum Frieden, folglich konnte ich entlassen werden, endlich kriminalisiert durch den zerstörten Frieden…
Das Aushalten zweier Wirklichkeiten, zweier Sphären macht die Ambivalenz seiner überzeugendsten Prosatexte aus, jene Doppelstruktur von Poesie und Arbeit. So zeigt etwa die Erzählung „Der Heizer“ die „Faszination dieser schmutz- und glutdurchlohten Keller“ und zugleich auch die Überwindung dieser Situation wie in den Gedichten: „Der Heizer spürt, daß er sich immer deutlicher in eine Figur seiner Imagination verwandelt hatte, in eine literarische Figur, deren Sprechtext immer weiter ins Banale abglitt“, weil er dort, wo er plötzlich die Zustände in seinem Kesselhaus kritisiert, schon als Person jenseits der aktuellen Situation gesehen wird:
Das ist hochinteressant, daß sie außerhalb der Arbeitszeit Volkskünstler sind, antwortete der neue Meister…
Hilbig beschönigt nichts, er beschreibt die Unterschiede zwischen Ingenieur, Meister, Arbeiter und Heizer als Ordnung von oben nach unten und nennt seinen Status „Sklavenstatus“, sehr zum Unwillen des starren ideologischen Überbaus. „Kommandowirtschaft“ in Reinkultur, wie sie jetzt allseits erst für den Westen bekannt wurde. Hilbig schildert ein Modell. Das Heizwerk bleibt nicht nur das Schicksal des Heizers; denn die Rebellion verpufft in Hitze, Kohlenstaub und etablierter Ordnung. Auch ein Text wie „Der Arbeiter. Ein Essai.“ ist heute noch ein erkenntnisträchtiges Prosastück, in dem die einstige Staatsideologie vom Arbeiter als Renaissance-Menschen, der an den Schalthebeln der Macht steht, durch Hilbigs sprachliche Verwandlungskunst ad absurdum geführt wird.
Einer der seltsamsten, aber eindringlichsten Prosatexte, ist die 100-Seiten-Erzählung Die Weiber, die man in vielfacher Hinsicht als Schlüsseltext zum Verständnis Hilbigs und seiner existentiellen und gesellschaftlichen Situation in der DDR lesen kann.
Ein aus einer Werkzeugmacherei entlassener Arbeiter – es ist vorwiegend ein Frauenbetrieb – kämpft um seine Wiedereinstellung und zugleich um Einlaß in die Gesellschaft. Wie anders als durch Arbeit – so könnte das wohl symbolhaft gemeint sein – soll der Mensch sich bestimmen? Durch ihn sagt uns Hilbig, „Weiber“ klinge weiblicher als Frau(en), und zudem sei „Weiber“ ein Ehrenname für die Frauen; denn er erinnert sich, daß KZ-Wächterinnen wie die berüchtigte Ilse Koch – sie erscheint dem Erzähler in einem Kastrationstraum – ihre Gefangenen „die Weiber“ nannten. Deren abgeschnittenes Haar türmt sich im Traum zu Bergen, und da er hineingreift –, es ist eine der bewegendsten Szenen des Buches –, glaubt er ihre Seele zu spüren.
Doch je konkreter Hilbig mit seinem Protagonisten agiert, desto metaphorischer, chiffrierter wird alles. Oder täuschen wir uns nicht? Liegt nicht der Schmerz ganz offen? Ist es nicht eine Schmerzprosa, in der jeder Satz schon ein Aufschrei ist? „Die Weiber“ – in romanischen Sprachen sind die Synonyme für Frau immer Steigerungen, die positiv besetzt sind – auch bei Hilbig sind es die wirklich erotischen, die weiblichen Frauen und die geschundenen, leidenden Frauen. Und einzig ihnen fühlt sich der Protagonist nah. Durch ein Gitter von seinem Keller aus, wo er die alten Formen zu stapeln hat, die ihm die Haut zerschürfen und die Glieder verrenken (man könnte diesen Vorgang auch auf die Literaturformen übertragen), beobachtet er mit voyeurhafter Lust die schuftenden Frauen. Am Schluß schließlich blickt er vom Dach der Gefängniswäscherei auf „Weiber“, die ihm abhandengekommen waren. Und er schreit die drei Worte herunter, die er ewig bei sich trug:
Ich liebe dich.
Die Antwort aber kommt von einigen Frauen in Form eines obszönen Zeichens, es ist „ein Zeichen gegen den reinen Staat“. Frauen in Funktion, im Amt waren Teil der Männergesellschaft der DDR. Sie standen „in der Liebe zum Staat“, und das bekommt Hilbigs Arbeiter auch zu spüren: durch die „leitende Genossin“ des Amts für Arbeit, durch die Frau Staatsanwältin (man denke an Hilde Benjamin, die gefürchtete „rote Hilde“), die er am liebsten bitten würde, öffentlich Frauenkleider tragen zu dürfen. „Frau Justiziar“, „Frau Magister!“ Durch alle diese Frauen spricht auch die Stimme der Mutter, die wie alle seine Schriftstellerei als obszön ablehnt. Die Staatsanwältin ist zugleich der Vater und der Staat. „Sie sind mein Vater!“ schreit er sie an. Dieser Vater, der Staat, hat ihn gezeugt, und darum – so Hilbigs Konzeption – liebe die Mutter auch den Staat; Fremdbestimmung schon im Mutterleib? „Mein Leben war im Leib meiner Mutter zurückgeblieben“, lautet die furchtbare Anklage. Der Generalissimus Stalin, die Staatsanwältin, der Vater – sie sind die eine Person, das riesengroße, mächtige Staatsorgan, das alle Sexualität besetzt hält. Sex klang eben lange Zeit amerikanisch und war deshalb kapitalistisch gebrandmarkt. (Nur Honecker, wie man heute weiß, hatte seine Pornos aus dem Westen.) Bekanntlich, so Hilbigs Erzähler serös, daß es wieder komisch wirkt, hatte ja schon Lenin das Herumwühlen im Sexuellen als Marotte der Intellektuellen verdammt, Sex sei nichts für den klassenbewußten Proletarier. So habe es auch Clara Zetkin übermittelt – aus Liebe zu Lenin? Jedenfalls keine Zeile über Lenins Schwanz, wundert sich Hilbigs Erzähler. Und bei der Landesteilung kam es dann so, daß die Unterhälfte der Frauen, ohne daß sie es merkten, in die Westzone ging, also ab ins Lager der Reaktion, der Oberkörper aber, im Blauhemd verschlossen, und der Kopf blieben in der DDR. Über Hilbigs herrliche satirische Absicht hinaus wird deutlich, daß Sex als Tabu-Chiffre alles umfaßte, was sich dem offiziellen Zugriff, der Herrschaft der alten Männer entzog:
Dunkel ahnte man das Unheil, das von den Schwänzen ausging… der Untergang des Staates stand bevor, wenn man die Schwänze nicht unten halten konnte.
Wenn man diese Sentenz metaphorisch weiterspinnt, dann wissen wir heute, daß das „Unheil“ lang vor dem 9. November 1989 sich angebahnt hatte.
Heute, im Westen lebend, meint Hilbig seinen Text etwas relativieren zu müssen; in einem Gespräch sagte er mir:
Ich habe das Gefühl, daß die anarchistische Komponente, die die Sexualität hat, in allen Staaten immer so schnell wie möglich unter Kontrolle gebracht und abgekoppelt wird – durch die roten Viertel und die Pornoshops.
Insofern gibt es im Grunde auch keine unpolitische Sexualität. Hilbigs „Weiber“-Text ist ein herausragendes Exemplum dafür. In Fabrikkellern, auf Müllhalden, in irrlichternden Wahnträumen spielt sich das Leben von Hilbigs Figur ab. Die Wohnung der Mutter läßt sein „Held“ zur Müllhalde verkommen, weil er sich selbst in Dreck und Erde rückverwandeln will, um dem Urstoff Leben nahezukommen, aus dem die Weiber gemacht sind. Er will sich endlich selbst erschaffen. Das aber ist nur zu verwirklichen mit einer „kranken Sprache“ gegen den „sauberen“ Staat. Nur mit einer „kranken“ Sprache, meint Hilbigs Erzähler, kann (jetzt müßte man sagen: konnte) man in dieser Republik überleben. Hilbig hat es selbst, ohne Vorbild für andere sein zu wollen, in der Tat den anpassungsbereiten Kollegen, die nie seine Kollegen waren, vorgelebt – bis zu seinem Weggang 1980. Eines der ganz frühen Gedichte Hilbigs, mit dem auch unsere Auswahl eröffnet, beginnt so:
laßt mich doch
laßt mich in kalte fremden gehn zu hause
sink ich
in diesen warmen klebrigen brei
der kaum noch durchsichtig ist
der mich festhält der mich so
festhält…
Wolfgang Hilbigs Zuhause – so lesen wir es auch in „prosa meiner heimatstraße“ ist die Sprache, ist seine Dichtung, darunter die Lyrik, die für uns den gewichtigsten Teil seiner literarischen Produktion ausmacht. Deshalb sind die beiden Lyrikbände weitgehend vollständig in unsere Auswahl aufgenommen. Doch auch die hier abgedruckten Prosastücke zeugen von der brennenden Suchbewegung seiner poetischen Selbstzeugung.
Hans-Jürgen Schmitt, September 1990, Nachwort
Schwarzarbeit des Schreibens
– Zu Wolfgang Hilbigs Buch Das Meer in Sachsen. –
Nachdem Hilbig jüngst mit seinem bei S. Fischer verlegten Bestseller Alte Abdeckerei Aufsehen erregte, legte dieser ungewöhnlich talentierte Autor nun einen Sammelband vor, dem die Kritikergilde ähnliche Aufmerksamkeit schenkt. Das Buch enthält neben bestechenden, aus früheren Publikationen bekannten Erzählungen und Gedichten auch solche Texte, die bislang unveröffentlicht waren oder deren Urdrucke in weniger verbreiteten Anthologien und Zeitschriften erschienen.
Im ganzen betrachtet, bleibt es zunächst ein echtes Phänomen, wie der unter unwirtlichsten Bedingungen aufgewachsene Arbeitersohn (Jahrgang 1941), dem noch dazu von Haus aus jegliche höhere Bildung verwehrt wurde (der erziehungsberechtigte Großvater, ein Analphabet, scheute Schrift und Bücher gleich schwarzer Magie), sich einer derart gewaltigen, intuitiven, vokabelreichen Sprache bemächtigen konnte.
Daß Hilbig ein großer, hoffnungsvoller Poet ist, ein wirklicher Kenner und Beherrscher der dichterischen Materie, stellt er mit dem eben von der Büchergilde Gutenberg herausgebrachten Querschnitt erneut unter Beweis. Was er schreibt, erfordert einerseits höchste Konzentration, schlägt aber zum anderen unwillkürlich in Bann. Die Vollkommenheit des Ausdrucks und der brillante Schliff der Worte verwundern um so mehr, als Hilbig über zehn Jahre hinweg ein geradezu unvereinbares Doppeldasein bestritt. Als buchstäblich knochenhart arbeitender Heizer verdiente er sich in seiner Heimatstadt Meuselwitz den notwendigen Unterhalt – daneben (dies sagt sich so aalglatt leicht!) schrieb der völlig Unverstandene und mithin Unakzeptierte besessen Verse und Prosa, die keineswegs den Autodidakten verraten.
Im Nachwort zu Das Meer in Sachsen findet man Schaffensumstände skizziert, die an quälenscher Grauenhaftigkeit nichts zu wünschen übrig lassen:
Wolfgang Hilbig war… nahe daran zu verzweifeln, kaputtzugehen, sich totzusaufen. Über acht Stunden führte er täglich eine Montagetätigkeit in einer Braunkohletagebau-Landschaft aus, die ihn, wie wir aus einigen seiner Gedichte erfahren können, nicht nur physisch ermüdete. Seine Arbeitskollegen konnten mit seinen Gedichten absolut nichts anfangen, dennoch teilte er fast seine gesamte Zeit mit ihnen, tags auf der Arbeit, nachts im Wohnwagen… (Siegmar Faust).
Diesem kleinen biographischen Exkurs entnimmt man das Besondere, Unverwechselbare, das Hilbigs Dichtung bis ins Detail anhaftet: Er bedient sich einer gestochenen Hochsprache, deren düstere, aber auch vielschichtige Metaphorik an Georg Trakl oder Georg Heym erinnert, ohne dahingehend ererbte Substanz belegen zu können. Das Milieu, dem er entstammte, wies keinerlei Spuren von Intellektualität auf, geschweige denn war es mit irgendwelchen künstlerischen Ambitionen durchtränkt. Auf den Punkt gebracht, heißt das: Hier wühlte sich ein potentielles Genie eisern, unbeirrt und vor allem kompromißlos empor. Ein Argument mehr für die These, daß wirkliche Begabungen, wenn sie unmittelbar im Seelischen wurzeln, weder der gepriesenen Schreibschulen noch diverser Stilübungen bedürfen.
Hilbig redete sein Lebtag nicht den ideologischen Knauserern der inzwischen hinweggefegten DDR zum Munde, er paßte sich vielmehr im verborgenen an. Um zu überdauern, verpuppte er sich im Kokon der Poesie, frönte er heimlich der „Schwarzarbeit des Schreibens“. Unschwer läßt sich beispielsweise die blendende Novelle „Die Flaschen im Keller“ als feinnervige Allegorie auf das ehemals großenteils stumpfe und den Verordnungen ergebene Vegetieren der Ostdeutschen auslegen. Überhaupt sind es immer wieder bestimmte Abstraktionen des Verfassers, die ohne sich in nichtige Einzelheiten zu verlieren – einen Blick auf typische Abläufe verflossener sozialistischer Administration gewähren. Hilbig präsentiert sich als Meister Kafkaesker Symbolik, indem er den morbiden Funktionalismus des Honecker-Regimes sezierend durchleuchtet. Besonders die Kulturpolitik gibt dem Dichter Anlaß zu verzweifelt-zynischer Abrechnung:
Die Spürhunde der Realität haben die Sprache ausgerauft, der Tonfall der Realität ist das ätzende Agens, in dem die Stimmen der Lyrik ersticken…
Somit ist das Stichwort gefallen Lyrik ist das eigentliche Element, das in Hilbig wohnt. Seine in den Band integrierten Strophen belegen ein weiteres Mal, zu welch faszinierenden sprachlichen Eskapaden dieser Mann fähig ist. Seinem Timbre nach leistet er Einzigartiges für die neuere deutsche Literatur. Der Autor selbst faßte sich kürzlich bei einer Lesung weitaus bescheidener:
Ich versuche, die Grenze des mir Vorgegebenen zu erweitern.
Ulf Heise, Neue Zeit, 4.9.1991
Den verdirbt nicht mal der Westen
– Gespräch mit Thomas Rosenlöcher. Thomas Rosenlöcher ist Schriftsteller. Er lebt und arbeitet in Dresden und Beerwalde/Erzgebirge. –
Karen Lohse: Wo haben Sie Wolfgang Hilbig kennengelernt?
Thomas Rosenlöcher: Bei einem gemeinsamen Freund, dem Schriftsteller Wolfgang Hegewald, der auch damals schon schrieb. Hegewald wohnte in einer total verrotteten Gegend, der Leipziger Heinrichstraße, und lud öfters zu Feten ein. Einmal hieß es, dass Wolfgang Hilbig auch da sei. Ich hatte einige Gedichte von ihm gelesen und wollte unbedingt den Autor kennenlernen. Ich suchte und suchte, konnte ihn aber nirgends finden.
In der Küche stieß ich auf einen merkwürdigen Typen, der irgendwie überhaupt nicht zu den Anwesenden passte. Im ersten Moment dachte ich, er würde im Haus wohnen und hätte sich einfach so dazu gesetzt. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass ich neben Wolfgang Hilbig saß. Ich habe die ganze Nacht neben ihn gesessen und geredet. Heute denke ich, dass er immer wenn ich den Sozialismus retten wollte, heftig den Kopf geschüttelt und immer wenn ich den Sozialismus verfluchte, heftig genickt hat. Er selbst sprach nicht viel.
Ich hatte mir den Verfasser der Gedichte ganz anders vorgestellt, deshalb erkannte ich ihn nicht. Diesem Mann am Küchentisch war seine Herkunft eingeschrieben, ob er wollte oder nicht. Seinem ganzen Habitus haftete etwas Unintellektuelles an. Dass er grandiose Texte verfasste, war seinem Äußeren überhaupt nicht zu entnehmen. Umso bemerkenswerter fand ich im Nachhinein ihn und seine Texte. Das habe ich versucht mit dem Titel meines Essays über ihn auszudrücken – „Der Text von unten“1.
Lohse: War 1977 seine Bedeutung als Schriftsteller schon bekannt?
Rosenlöcher: Das war ja das Komische an der DDR. Wir waren alle Literatur-Spürnasen. Man roch das irgendwie. Es gab immer dieses Munkeln und Hörensagen. Man hatte ein Gespür für gute Literatur und ersetzte so die fehlende Literaturkritik, war vielleicht sogar besser, als es eine marktaffirmative Literaturkritik heute sein kann. Ständig wurde über Literatur geredet, diskutiert, wer gut sei, wer nicht und an wen man sich halten solle.
Lohse: Hat er sehr darunter gelitten, in der DDR nicht veröffentlichen zu können?
Rosenlöcher: Zu dieser Zeit waren wir ja alle unbeschriebene Blätter. Wie oft er vergeblich versucht hat, etwas unterzubringen, wusste ich damals nicht. Auch dass sie ihn längst auf dem Kieker hatten, ja dass er im Knast gewesen war – wegen des Herunterholens einer Fahne, glaube ich – habe ich erst später erfahren. Nun hat auch er ziemlich lange gebraucht, um schreibend er selber zu werden. Anfangs sind seine Sachen ja manchmal noch etwas Pubertär-Pathetisch gewesen, auch die Dunkelheiten stammten manchmal eher aus zweiter Hand – französischer Symbolismus. Das auch schon vorhandene Eigene musste ein Redakteur also nicht unbedingt erkennen. Das Dumme damals war nur, dass man nie recht wusste, ob solche Kunst- Einwände nicht bloß vorgeschoben waren und die Ablehnungen nicht am Ende doch politisch. Später ist Hilbig für die Offiziellen jedenfalls kaum noch druckbar gewesen, auch wenn es einen Einbürgerungsversuch, immerhin bei Reclam, noch gegeben hat: stimme stimme – vor allem die Prosa habe ich schon mit großer Ehrfurcht gelesen.
Die Ironie der Geschichte ist ja, dass hier ein Arbeiter in einem Land zum Dichter wurde, das sich gerade von Arbeiter-Dichtern Legitimation erhoffte. Und dass dieser Arbeiter-Dichter dieses Land dann als Hölle beschrieb.
Lohse: Hat sich dieses Düstere der Texte auch in seinem Wesen widergespiegelt?
Rosenlöcher: Er konnte sehr kollegial sein, ja sogar menschenfreundlich, allerdings nur bis zu einem bestimmten Maße. Es gab bei ihm wie bei jedem das sogenannte normale Gesicht, aber man spürte, dass da noch etwas anderes, Untergründigeres war. In seiner groben, unbehauenen Erscheinung steckte ein Geheimnis. Es war etwas an ihm, das nicht ganz einzuordnen war und davon wurde man angezogen. Insofern wirkte er eben doch außergewöhnlich – wie die Sachen, die er schrieb.
Lohse: War die Stasi ein Thema, was man damals miteinander besprochen hatte?
Rosenlöcher: Man sprach schon darüber, doch meist eher nebenbei. Nach 1989 wurde das viel mehr diskutiert. Wir waren uns schon darüber klar, dass die Stasi ihre Leute überall hatte. Bei jeder privaten Lesung war einer dabei. Man wusste auch, dass Leute verhaftet wurden. Wir haben das aber nicht ständig thematisiert, weil man sich sonst verrückt gemacht hätte. Es war ein Hinnehmen und sich nicht allzu sehr davon beirren lassen. „Lachen wir sie kaputt“ war damals so ein Spruch gewesen.
Es wurde nach der Wende oft gesagt, wir hätten damals eine Sklavensprache verwendet, hätten versteckt geschrieben, um das Thema Stasi deutlich werden zu lassen. Das ist aber ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag. Wir sind keine Sklaven gewesen. Das geht mir zu weit. Wir haben versucht mit der eigenen Stimme das zu sagen, was zu sagen war und dabei sich selbst treu zu bleiben. Wenn Verstellung eine Rolle spielte, war das eher gut für die Gedichte. Literatur lebt von der Verwandlung. Und wenn man nicht Staatssicherheit sagen konnte, weil das Gedicht dann nicht gedruckt wurde, sondern ein anderes Wort verwendete, war das für die Literatur gar nicht schlecht.
Lohse: Wie waren die Reaktionen auf seine Ausreise 1985?
Rosenlöcher: Es war eigentlich immer das gleiche Gefühl, wenn wieder jemand wegging. Man sah es ein:
Jetzt ist auch der gegangen und er hat natürlich Recht, dass er geht.
Man war traurig darüber, aber die Grundformel war:
Wer gehen kann oder muss, der soll gehen. Aber wer bleiben kann, der soll auch bleiben
der Konsens aller Intellektuellen in der DDR. Das ist nach 1989 nur in Vergessenheit geraten, indem man sich dann dergleichen gegenseitig vorwarf. Gerade Hilbig aber war durch seine Bücher, die bald darauf im Westen erschienen, für mich immer noch anwesend.
Lohse: Wie haben Sie ihn in Edenkoben erlebt?
Rosenlöcher: Ich hatte 1990 für das Künstlerhaus Edenkoben ein kurzes Stipendium bekommen. Hilbig wohnte schon seit 1988 dort. In den folgenden Monaten haben wir uns oft besucht und viel geredet. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern: Es gibt eine Erzählung von ihm, die ich sehr mag – „Über den Tonfall“ – und die ich damals gerade wieder neu gelesen hatte. Mit dem Text in der Hand bin ich zu ihm hin und sagte:
Ich könnte heulen, so gut ist die Geschichte.
Das ist etwas, was man selten macht, wenn man selber schreibt. Er hat es gern zur Kenntnis genommen, aber nach außen hin nicht so nah an sich rangelassen.
Damals war gerade die erste Zeit, wo er nicht mehr trank und manisch am Schreiben war. Wenn ich zu ihm kam, sagte er immer wieder zu mir: Ich muss noch den Satz fertig machen, diesen einen Satz… Er war so aufgeregt, dass er stotterte. Ich sagte:
Geh den Satz schreiben!
Meistens ging er aber nicht. Man merkte, wie sehr er in seinem Schreiben drin war, wie er es voll lebte und das war der eigentliche Wolfgang Hilbig. Er holte seine Bilder hervor und schrieb. Er kämpfte solange, bis das einzelne Bild saß, der Satz stimmte, die Stimmung da war. Daran hat er in seinen Nächten hart gearbeitet. Ich habe ihn in dieser Edenkobener Zeit eigentlich nur schreibend erlebt. Bis auf Lesereisen oder wenn Freunde ihn besuchten, nahm er kaum am äußeren Leben teil.
Wir haben immer davon gesprochen, dass wir zusammen im Wald spazieren gehen wollen. Der Wald war ungefähr 10 Minuten von seinem Haus entfernt. Ich glaube, er ist in seiner ganzen Edenkobener Zeit nicht einmal in diesem Wald da oben gewesen. Auch kaum in den Weinbergen. Es war sowieso eine Landschaft, die diametral zu ihm stand. Er wirkte wie ausgesetzt, passte dort überhaupt nicht hin. Er lebte wie im Exil: Eine Gegend, die ihn eigentlich nicht interessierte und die er in keiner Weise in seinen Tagesrhythmus einbezog. Er war dort immer im Stipendium, auch wenn er keins mehr bekam.
Lohse: Wie schätzen Sie das Verhältnis von Schreiben und Trinken bei ihm ein?
Rosenlöcher: Dass er während des Schreibens getrunken hat, glaube ich eher nicht.
Das würde auch meiner Theorie widersprechen, dass er mit den Sätzen gekämpft hat. Wenn man trinkt, kann man nicht mit den Sätzen kämpfen, dann fehlt die Kontrolle und das Gefühl für das Ungenügende am Text. Ich glaube eher, dass es umgekehrt war: Wenn er schrieb, konnte er dem Trinken entkommen. Dennoch spiegeln seine Texte das Rauschhafte des Trinkens wieder. Ein merkwürdiger Widerspruch: Ohne Rausch, ohne das Trinken, wäre die ganze Hilbigsche Literatur nicht so, wie sie ist. Und gleichwohl war das Schreiben seine einzige Möglichkeit dem Trinken zu entkommen.
Lohse: Er ist mit der Maschinerie des Literaturbetriebs sehr skeptisch umgegangen. Warum?
Rosenlöcher: Weil er sich auch dem Westen nicht als völlig zugehörig empfand.
Schon einer seiner Buchtitel sagte das: Das Provisorium. Und weil er besser als andere wusste, wie sehr uns der Selbstdarstellungs- und Vermarktungszwang korrumpiert. „Wir können ja schon nicht mehr anders“, sagte er einmal grimmig zu mir. Die ständige Vorleserei war ihm auch Verrat an der Literatur. Trotzdem hat er es gern gemacht – wie wir alle. Solche Lesungen helfen ja auch, sich nützlich und gebraucht vorzukommen. Hilbig hat viel gelesen und gewiss gar nicht schlecht verdient. Trotzdem machte er immer den Eindruck, als wäre er gerade am Verhungern. Die Kunst beherrschen viele von uns. Gerade die Ostler, merkwürdigerweise. Da ist wohl auch Angst vor dem Absturz dahinter, vor dem plötzlichen Absturz in dieser westlichen Welt, von der einem ja nicht unbedingt an der Wiege gesungen worden ist.
Alles in allem aber gehörte Wolfgang für mich zu den Ausnahmemenschen, bei denen man sich vollkommen sicher sein konnte: Was dem auch immer passiert, welchen Erfolg der auch immer haben wird – der bleibt sich immer gleich. Den verdirbt nicht mal der Westen.
Aus Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Plöttner Verlag, 2008
„Den Debilen markieren…
und dann vielleicht klammheimlich Schreiben.“
– Ein Porträt des Arbeiters und Schriftstellers Wolfgang Hilbig. –
Kann man Vom Nachteil, geboren zu sein schreiben und nachher einen Literaturpreis dafür annehmen?
E. Cioran
Nur vierzehn Gedichte und eine nach Zensureingriffen genehmigte Anthologie durfte der 1941 im thüringischen Meuselwitz geborene Schriftsteller Wolfgang Hilbig in seiner Heimat, der DDR, veröffentlichen. Sein erstes Buch, ein Gedichtband, erschien 1979 in Westdeutschland. Die Emigration dorthin gelang ihm 1985. Da hatte er bereits den für ihn verhängnisvollen Ruf, ein DDR-Autor und Arbeiterdichter zu sein, den er sein Leben lang nicht mehr loswerden sollte. Er selbst zog die Bezeichnung „Arbeiter und Schriftsteller“ vor, denn er war der Meinung, dass sie sein „Doppelleben“ angemessener repräsentierte. Aber das interessierte die west-, dann die gesamtdeutschen Literaturkritiker sowie die preise- und stipendienvergebenden Stellen in der BRD und nach der Wiedervereinigung nicht sonderlich. Um ihre Besprechungen und ihre Juryentscheidungen zu legitimieren, brauchten sie einen „Markenartikel“ (Iris Radisch), was eine Ausdifferenzierung erschwerte. Dass der Markenartikel ein „zu lange DDR-Wein“ trinkender Arbeiter im Arbeiterstaat und ein wie ein Schlot rauchender unkorrumpierbarer Schriftsteller im real existierenden Sozialismus in einem war, passte wie die Faust aufs Auge, hätte der Betroffene vermutlich selber gesagt. Er war in seiner Jugend Boxer. Daher seine Boxernase.
Auf den Bildern, die Jürgen Bauer 2002 für ein Interview mit Hilbig in Turin machte, hält dieser die dunkelgelben Raucherfinger seiner rechten Hand, in der eine brennende Zigarette liegt, der Kamera entgegen. Die Tonbandaufnahme einer Lesung, die der Autor im März 2006 noch bestritt, dokumentiert einen trotz Atemnot und starkem Husten lesenden und Fragen beantwortenden Autor. Ein Jahr später, kaum ins Rentenalter eingetreten, musste er schließlich gehen, starb 2007, fünf Jahre nach Erhalt des Büchner-Preises.
In der Zählung des Literaturkritikers Matthias Biskupek ist diese Auszeichnung eine von insgesamt achtzehn gewesen, die Hilbig zeitlebens erhielt. So dass der Schluss naheliegt, dass er mit seinem Ruf gut gefahren ist. „Ich schäme mich ja fast. So viele Preise…“, sagte Hilbig 2002, nachdem er erfuhr, dass er der nächste Träger des Büchner-Preises sein würde. Das war keine falsche Bescheidenheit. Er hat von Anfang an gegen den eigenen Erfolg angekämpft. Wenn auch ohne Erfolg. Ob in seinen Romanen, Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Preisreden oder Interviews – stets ging er den sogenannten Literaturbetrieb hart an. Doch der nicht besonders Theoriebegabte führte nie Metadiskussionen über dieses fiktive Konstrukt, von dem so schwer zu sagen ist, wo es anfängt und wo es endet, und zu dem jeder ernstzunehmende Schriftsteller ein ambivalentes, nie rein affirmatives, nie rein aversives Verhältnis hat. Nein, er schrieb und sprach darüber, wie er es über die Ost-Betriebe tat, in denen er einst als Heizer malochte: mal liebevoll, mal voller Verachtung, immer unverblümt.
Bis zu seinem letzten Roman Das Provisorium (2000), eine endgültige Abrechnung mit dem Literaturbetrieb, versuchte er, das Gleichgewicht zu halten. Das Verhältnis brach er erst ab, als er verstand, dass er im Literaturbetrieb derart „wohlgelitten“ (Matthias Biskupek) war, dass nicht einmal scharfe Kritik daran den Status des Wohlgelittenen ändern oder zumindest ergänzen würde. In den sieben Jahren nach Erscheinen von Das Provisorium kam seine Textproduktion dann weitgehend zum Erliegen. Bei den Büchern, die danach erschienen, handelte es sich um Sammlungen von größtenteils davor entstandenen Texten.
Dass einigen Interviewpartnern – wie Jürgen Krätzer, dem kürzlich verstorbenen Herausgeber der Literaturzeitschrift die horen – auffiel, dass seine Kritik am Literaturbetrieb im Besonderen und seine Kulturkritik im Allgemeinen in Besprechungen „völlig ausgeblendet“ wurden, änderte nichts an der sonstigen medialen Ignoranz, die ihn mit Preisen und Stipendien großzügig belohnte. Die zwei Ausnahmen waren Richard Herzinger 1995 in der Zeit und Frank Schirrmacher 1997 in der FAZ. Das eine Mal wegen der Ablehnung der „Autogesellschaft“, die begonnen habe, „uns zu verschlucken“ (Abriss der Kritik), das andere Mal wegen des Vergleiches der Wiedervereinigung mit einer kolonialistischen „Unzucht mit Abhängigen“ (Kamenzer Rede zum Lessing-Preis). Beide warfen ihm Naivität vor und suggerierten, er solle sich lieber auf das Verfassen literarischer Texte beschränken.
Hilbig kritisierte indirekt den „Konsens“ unter Preisjuroren, wonach einige wenige Schriftsteller, zu denen er ja selbst gehörte, „einfach wichtig“ seien und überleben müssten, weshalb ihnen eine Art Blankoscheck zustünde, nach erreichtem Status im Grunde völlig unabhängig von der jeweiligen literarischen Entwicklung. Sein Beispiel war der österreichische Schriftsteller Ernst Jandl, der Verfasser von ottos mops. Dieser habe „alle Preise in Österreich und Deutschland erhalten, die jemals existiert haben“, „fast jedes Jahr einen bekommen“.
Als er einen Schweizer Schriftsteller mit den Worten zitierte – „Wir müssen zehnmal besser schreiben als ein DDR-Autor, um einen Verlag in der Bundesrepublik zu finden“ –, hatte er schon die Erfahrungen einiger seiner Ost-Kollegen vor Augen. Deren Ost-Bonus, den ihnen ihre Herkunft einst garantiert hatte, ging spätestens nach dem mehrphasigen Literaturstreit nach Erscheinen von Christa Wolfs Was bleibt endgültig in die „Gegenrichtung“, nach hinten los.
Und nicht einmal seine Anleitung, wie man als DDR-Autor den eigenen Ost-Bonus erzwingen konnte durch die „Vorspiegelung der Tatsache, ein in der DDR von der Zensurbehörde behinderter Autor zu sein“, wurde aufgegriffen. Hilbig selbst habe die Absagen vorprogrammiert, etwa dann, wenn er ostdeutsche Publikationsorgane mit Texten beschickte, die er selbst „als wenig gelungen“ angesehen habe oder „die aufgrund ihrer Aggressivität von vornherein keine Chance in den Augen eines DDR-Lektors haben konnten“.
„Grinst einem da nicht die von Ihnen beschriebene ‚Dekadenz des Literaturbetriebs‘ entgegen, der selbst seinen Abgesang noch feiert?“, wurde Hilbig einmal gefragt. Die Antwort erstreckte sich über mehrere Interviews und Interviewpartner. Irgendwann führte er, als würde er erneut über die Autogesellschaft sprechen, die Metapher des omnivoren Allesfressers ein:
Der Kulturbetrieb frisst alles. Da rennt man mit dem Kopf gegen Wände und wird zurückgefedert.
Es ist eine Metapher für dieselbe Struktur, die der US-amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace 1993 in seinem bahnbrechenden Aufsatz „E Unibus Pluram“ am amerikanischen Fernsehen ausmachte, als er über die „Ironie“ und die „Selbstverarschung“ des Fernsehens schrieb und dabei dessen Strategie der Immunisierung gegen die Kritik hervorhob: Es verinnerliche in seiner Selbstbezüglichkeit und seiner „zynischen, postmodernen Attitüde gegen sich selbst“ die Kritik und verkaufe sie als Teil des Programms. Es gönne einem die „Entfremdung vom Fernsehen“, in der heimlichen Absicht, ihn „erst recht ans Fernsehen zu binden“.
Die Ignoranz, mit der Hilbigs Kritik am Literaturbetrieb bedacht wurde, aber auch die Vehemenz, mit der er von Herzinger und Schirrmacher auf seinen Literatenplatz verwiesen wurde, legen freilich den Verdacht nahe, dass es dem Literaturbetrieb kaum darum gehen kann, wie ein Schriftsteller präsent bleibt. Ihm geht es darum, dass er es tut. Die relativ lange Lebensdauer von anfänglichen markanten Produktkennzeichnungen – Markenartikel, Made in East Germany – prästabiliert und immunisiert die künftige öffentliche Wahrnehmung weitgehend gegen neue Entwicklungen ein und desselben Schriftstellers. Die Sanktionen des Literaturbetriebs richten sich einzig gegen den absenten Schriftsteller. Wenn er nach erreichtem Status „einfach wichtig“ präsent bleibt, bleibt auch dieser mehr oder weniger stabil. Die Statuten des Sanktionierungsbetriebs sehen für solche Fälle keine gravierenden Eingriffe vor.
Das war Hilbigs Hauptkritik. Er, Relikt aus einer vergangenen Epoche und vielleicht der deutschen Literatur letzter Existentialist von Format, dem nur der absolute Ernst lag und dem beim besten Willen keine postmodernen Zynismen oder irgendwelche Inszenierungsstrategien abzugewinnen waren, sah keinen anderen Ausweg, als sich ganz zurückzuziehen. Nachdem er einsehen musste, dass der Literaturbetrieb ihn der Mitautorschaft an seinen ungeschriebenen Gesetzen beraubt hatte, packte er seine Siebensachen – der größte Luxus sei ihm gewesen, „nicht mit der U- und S-Bahn zum Berliner Ostbahnhof zu fahren, sondern mit dem Taxi“ – und ging von dannen, lange bevor er von dannen ging.
In Provisorium heißt es über den Schriftsteller C., er habe anfänglich für Gott und sich selbst geschrieben, was „auf einer ganz banalen Ebene dasselbe“ gewesen sei. Jetzt sehne er sich zurück zu jenem „fernen kindischen Zustand“, den er jedoch als „Angestellter des Literaturbetriebs“ nicht mehr werde erreichen können. Eine nicht loszuwerdende „Krätze“ sei der Literaturbetrieb:
Die einzige Möglichkeit war, zusammenzubrechen und überhaupt nichts mehr zu schreiben. Den Debilen markieren… und dann vielleicht klammheimlich schreiben, das Sozialamt durfte davon keinen Wind bekommen…
1968 war Hilbig derart verzweifelt, bis dato nur für Gott und sich selbst geschrieben zu haben, dass er auf der Schwelle zum Literaturbetrieb bereit war, Eintritt zu zahlen. Er beschickte die ostdeutsche Literaturzeitschrift ndl mit der Annonce „Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte? Nur ernstgemeinte Zuschriften an: W. Hilbig, 7404 Meuselwitz, Breitscheidstraße 19b“ und bat um die Rechnung im Falle eines Abdrucks, zu dem es dann tatsächlich kam. Dieser Paratext war Hilbigs erste nennenswerte Veröffentlichung. Am Ende hätte sich der Literaturbetriebsangestellte am liebsten freigekauft.
Alexandru Bulucz, Merkur, 24.6.2019
FREUNDE
für W. H.
Wie die Vogelscheuchen im Baum,
so hängen wir, Freunde, in dieser Zeit.
Was uns niemals gehörte: es ist soweit,
es zu verlassen. Was war, es war ein Traum.
Kurt Drawert
DIE LIEBE (Wolfgang Hilbig)
Mein Auftrag war
ihn
zwei Tage
im Vogtland
zu begleiten
auf seinen Lesungen
zu moderieren
Er stand
in der schönen Buchhandlung
meiner Heimstadt
sagte vorauseilend
wir kennen uns ja
aber wir kannten uns nicht
Er sah meine Frau
später mein
nach langer Abwesenheit
wieder gewonnenes zu Hause
Ich hatte eine Frau
und ein zu Hause
Er sagte (wörtlich):
Alles hat geklappt
ich habe Geld
und man kennt mich
Aber die Liebe…
Niemals im Leben
stand ich
einem Menschen
gegenüber
so hilflos
3. April 2017
Utz Rachowski
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Pauline de Bok: Der Mann aus Meuselwitz. Prosa und Lyrik von Wolfgang Hilbig – Kommentar und Übersetzung
Leben habe ich nicht gelernt. Jürgen Holtz liest Texte von Wolfgang Hilbig aus Anlass des ersten Todestages von Wolfgang Hilbig. 5. Juni 2008. Eine Veranstaltung der Galerie auf Zeit – Thomas Günther – in Zusammenarbeit mit den Tilsiter Lichtspielen Berlin-Friedrichshain.
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Hilbigs Moderne. Auf die Suche nach den Quellen und Gesichtern von Hilbigs Moderne gehen: die Schriftsteller Peter Wawerzinek (Unangepasstheit als Lebensprogramm) Ingo Schulze (poetische Traditionen), Dieter Kalka (Moderator), Sebastian Kleinschmidt (Hilbigs Lesebiografie – seine Quellen der Moderne), Clemens Meyer (Nacht-Topos bei Hilbig)
Herr Hilbig, bitte Platz nehmen in der Weltliteratur! Mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller (Hilbigs singuläre Poetik), den Schriftstellern Clemens Meyer (Wirkungen in anderen Ländern, von den USA bis Italien), Ingo Schulze (poetischer Anspruch vs. Mainstream), Peter Wawerzinek (Chancen für poetische Eigenart heute), Alexandru Bulucz (Hilbigs Poetik – Fortsetzung bei den Jungen) und dem Verleger Michael Faber (Verlegerfahrungen mit einem Dichter), moderiert von Andreas Platthaus
Wolfgang Hilbig Dichterporträt. Michael Hametner stellt am 3.11.2021 in der Zentralbibliothek Dresden den Dichter vor. Mit dabei am Bandoneon Dieter Kalka.
Helmut Böttiger: Hilbig – die Eigenart eines Dichters. Geburtstagsrede auf einen Achtzigjährigen
Vitrinenausstellung und Archivsichtung „Der Geruch der Bücher – Einblicke in die Bibliothek des Dichters Wolfgang Hilbig“ am 3.6.2022 in der Akademie der Künste
Wolfgang Hilbig am 29.1.1988 im LCB
Wolfgang Hilbig am 26.11.1991 im LCB
Gesprächspartner: Karl Corino, Peter Geist, Thomas Böhme
Moderation: Hajo Steinert
Lesung Wolfgang Hilbig am 13.3.2006 im LCB
Gespräch und Lesung I – Thomas Geiger spricht mit Wolfgang Hilbig über seinen Werdegang, der Autor liest Gedichte aus dem Band abwesenheit.
Gespräch und Lesung III – Gespräch über die Auswirkungen von Hilbigs Stipendienaufenthalt in Westdeutschland 1985, anschließend liest er aus seinem Roman Ich.
Gespräch IV – Thomas Geiger fragt Wolfgang Hilbig, ob er sich von der Staatssicherheit bedrängt fühlte, anschließend führt Hilbig in die Lesung ein.
Gespräch V – Wolfgang Hilbig berichtet von seinen Bemühungen in der DDR an bestimmte Literatur zu gelangen.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ralph Rainer Wuthenow: Anwesend!
Die Zeit, 30.8.2001
Helmut Böttiger: Des Zufalls schiere Ungestalt. Gespräch
Der Tagesspiegel, 31.8.2001
Welf Grombacher: Ein Jongleur der Elemente
Rheinische Post, 31.8.2001
Horst Haase: Weisheit eines Geplagten
Neues Deutschland, 31.8.2001
Richard Kämmerlings: Geschichte und Geruchssinn
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2001
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Gunnar Decker: Der grüne Fasan
Neues Deutschland, 31.8.2006
Christian Eger: Der Mann, der aus der Fremde kam
Mitteldeutsche Zeitung, 31.8.2006
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Jayne-Ann Igel: Das Dunkle oder Die Vordringlichkeit von Tatsachen
der Freitag, 31.8.2011
Ralph Grüneberger: Heute vor 70 Jahren wurde Wolfgang Hilbig geboren
Dresdner Neueste Nachrichten, 31.8.2011
Zum 1. Todestag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: „Vom Grenzenlosen eingeschneit“.
Neues Deutschland, 2.6.2008
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Jörg Schieke: eisiger regen fressende kälte
MDR, 30.8.2016
Christian Eger: Schriftsteller Wolfgang Hilbig „In Deutschland gibt es keine Dichter mehr“
Mitteldeutsche Zeitung, 1.9.2016
Beulenspiegels literarische Irrf-Fahrt 4: Wolfgang Hilbig zum 75. Geburtstag
machdeinradio.de, 2.9.2016
Wilhelm Bartsch: Am Ereignishorizont von Wolfgang Hilbig
Ostragehege, Heft 87, 5.3.2018
Zum 1o. Todestag des Autors:
Clemens Meyer: „Diese Sprache schneidet mich regelrecht auf!“
MDR, 2.6.2017
Zum 11. Todestag des Autors:
Eine Wanderung zum 11. Todestag von Wolfgang Hilbig durch seine Geburtsstadt.
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Internationales Wolfgang-Hilbig-Jahr 2021/22
Eberhard Geisler: 80. Geburtstag von Wolfgang Hilbig – Paul Celans Bruder
Frankfurter Rundschau, 30.8.2021
Nils Beintker: Einer, der sich nicht duckte: Wolfgang Hilbig
Br24, 30.8.2021
Karsten Krampitz: Als einer den Wessis von der DDR erzählte
der Freitag, 31.8.2021
Wilhelm Bartsch: Warum die Dichtkunst von Wolfgang Hilbig wesentlich für das Werk von Wilhelm Bartsch war
mdr Kultur, 31.8.2021
Ralf Julke: Die Folgen einer Stauseelesung: Am 31. August wird die Gedenktafel für Wolfgang Hilbig enthüllt
Leipziger Zeitung, 29.8.2021
Cornelia Geißler: 80 Jahre Wolfgang Hilbig: Botschaften über die Zeiten hinweg
Berliner Zeitung, 31.8.2021
Cornelia Geißler: Hilbigs Flaschen im Keller und die Schrift an der Wand
Berliner Zeitung, 2.9.2021
Frank Wilhelm: Ein unbeugsamer Poet ließ sich nicht verbiegen in der DDR
Nordkurier, 1.9.2021
Constance Timm: Versprengte nacht – Wolfgang Hilbig zum 80. Geburtstag
MYTHO-Blog, 31.8.2021
Helmut Böttiger: Giftige Buchstaben, brütendes Moor
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2021
Zum 15. Todestag des Autors:
Vor 15 Jahren starb Wolfgang Hilbig. Eine Kalenderblatterinnnerung von Thomas Hartmann
Wolfgang Hilbig. Die Lyrik. Anja Kampmann, Nico Bleutge und Alexandru Bulucz erforschen im Literarischen Colloquium Berlin am 4.10.2021 in Lesung und Gespräch den lyrische Kosmos des Autors.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Interview + KLG + IMDb +
YouTube + Internet Archive + Kalliope + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Wolfgang Hilbig: FAZ ✝ Die Welt ✝ Die Zeit 1 +2 ✝
titel-magazin ✝ Goon Magazin ✝ Spiegel ✝ Focus ✝ der Freitag ✝
Der Tagesspiegel ✝ NZZ ✝ ND ✝ BZ ✝ taz ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Claudia Rusch: How does it feel?
Neue Rundschau, Heft 2, 2008
Christian Eger: Im Abseits arbeiten
Mitteldeutsche Zeitung, 4.6.2007
Sebastian Fasthuber: Wolfgang Hilbig 1941–2007
Der Standard, 4.6.2007
Christoph Schröder: Wie sich das Ich auflöst
Frankfurter Rundschau, 4.6.2007
Uwe Wittstock: Wolfgang Hilbig-Wegweiser ins Unwegsame
uwe-wittstock.de
März, Ursula: Als sie noch jung waren, die Winde
Die Zeit, 14.6.2007
Uwe Kolbe: Eingänge, Zugänge, Abgänge
Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Der Wunderhorn Verlag, 2008
Günter Gaus im Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig. Aus der Reihe Zur Person, gesendet am 2. Februar 2003



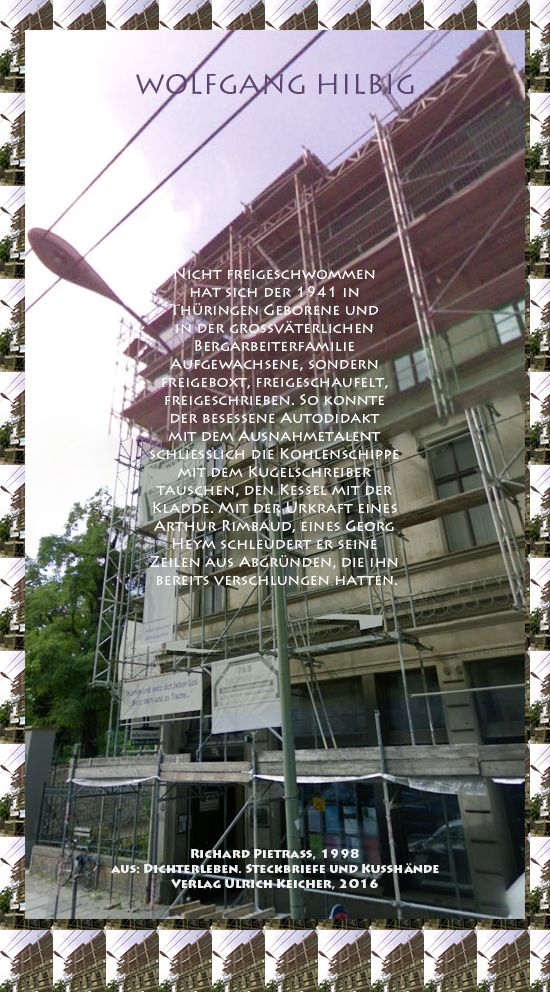












Schreibe einen Kommentar