Wolfgang Weyrauch (Hrsg.): Expeditionen
Stirn und Scheitelknochen,
Inseln unter dem Wind,
Wo tief die Zitterrochen
meiner Gedanken sind.
Thule und beide Sizilien
Hinter Heu irgendwo.
Ich schweige im Blau, ich spiele
Träumerisch mein Jo-Jo.
Still geht der Tag zur Neige,
Mir liegt nichts daran.
ich halte mit meinem Zeige-
Finger die Zeiten an.
Länger wird der Schatten,
Vita brevis est.
Was war, das wir bejahten?
Es gibt uns den Rest.
Jabos, fliegende Fische,
Treiben ins Wolkennetz.
Die Nacht, die zauberische,
Erfüllt ihr Gesetz.
Rotliegendes über den Gärten –
Ihr Hunde, geht in die Knie!
Abends beim Dunkelwerden:
To be or not to be!
Werner Riegel
An die Leser
Dichtung ist das Tagebuch eines Seetiers, das auf dem Land lebt und durch die Luft fliegen möchte.
Carl Sandburg
Ich bitte Sie herzlichst, sich an diesen Expeditionen zu beteiligen. Ja, bitte, betrachten Sie die Lektüre dieses Buchs wirklich als eine Expedition. Sie wissen genau so wie ich, was alles man auf eine Expedition mitnehmen muß, oder sie mißglückt. Was mich betrifft, so scheint mir, daß man besonders ohne die Überzeugung: ,die Expedition wird gelingen‘ nicht auskommen kann. Und zum Ziel kann man ohne diese Überzeugung schon gar nicht gelangen. Was aber ist, in unserem Fall, das Ziel? Nun, ich denke, ganz einfach dies, wenn ich mich in Ihre Lage versetzen darf: ich, der Leser dieses Lyrikbandes, versuche, mich mit den neuen deutschen Gedichten auseinanderzusetzen, ich habe den guten Willen dazu, ich habe mir vorgenommen, geduldig zu sein, keine Scheuklappen zu haben, das Unverständliche, das Fremde, falls es mir begegnet, mir verständlich und vertraut zu machen, und wenn ich es siebenmal lesen müßte, ich weiß, daß ich es schwer haben werde, aber ich hoffe, keiner der Autoren, die in diesem Buch gedruckt sind, macht es mir unnütz schwer, indem er mir ein X für ein U macht, das heißt, er macht mir vor, sein Gedicht sei etwas, und dabei ist es nichts, seine Zeilen seien es wert, mich an dieser Expedition zu beteiligen, und in Wirklichkeit foppen sie mich nur, ich hoffe, daß die Anstrengungen, denen ich mich unterziehe, sich lohnen, ich weiß, ich muß sie auf mich nehmen, diese Gedichte sind so, wie sie eben sind, natürlich könnte ich den Band in eine Ecke werfen, aber dafür habe ich ihn schließlich nicht gekauft, ich habe ihn erstanden, um mich zusammen mit diesen Dichtern in jene Gegenden der Sprache und des Lebens zu begeben, die sie vor mir entdeckt, betreten und durchforscht haben, ich stecke mir die Beile der Gelassenheit, des Muts, der Ausdauer und der Teilnahme ein, und so wird es mir sicher glücken, Schneisen durch den Urwald zu schlagen und Lichtungen zu finden. Erlauben Sie mir, Ihnen bei Ihrem Marsch etwas behilflich zu sein. Denken Sie nicht, daß ich Sie bevormunden will. Nein, ich möchte nur vorschlagen, Sie und ich lesen jetzt gemeinsam das folgende Gedicht Helmut Heißenbüttels, das in seinem Buch Topographien steht (1956 im Verlag Bechtle, Eßlingen, erschienen):
Inhaltlose Sätze im Nachtdrift
wirkliche nächtliche Straßenbahngesprächsfetzen
Stimmen über dem Eis
das menschenleere Gesicht das ich erkenne
ein Tag vor Weihnachten
Nachtland Nachtblau
geflügelte Peripetie der Nacht
die milchbraune Kreisform
jetzt jetzt jetzt jetzt
Und lassen Sie mich obendrein versuchen, diese neun Zeilen zu erklären, sofern sie es nötig haben, und sofern ich dazu imstande bin. Ich finde, sie haben es keineswegs nötig. Aber vielleicht sind Sie anderer Meinung. Übrigens ist es selbstverständlich, daß mein Versuch, dieses Gedicht zu erläutern, ganz falsch sein kann. Wie dem auch sei, ich stelle mir vor, eine solche Auseinandernahme vermöchte für unser Gespräch recht nützlich zu sein. Ja, ich konnte mir sogar denken, daß selbst eine unrichtige Darstellung des Gedichts bei Ihnen richtige Schlüsse bewirken wird. Verhärten Sie sich aber nicht von vornherein, ich bitte Sie sehr, indem Sie sagen, ein Gedicht, dem man eine Erklärung beigebe, sei kein Gedicht. Zweifellos ist es Ihr gutes Recht, so etwas zu sagen. Doch mir scheint, sowohl Gedichte, mit Erklärung als auch Gedichte ohne Erklärung könnten gut oder schlecht sein.
Aber jetzt zu dem Gedicht Heißenbüttels. Die Zeilen 1 bis 8, meine ich, bereiten das viermalige „jetzt“ in der 9. Zeile vor, dieses jähe Wort, das eigentlich immer an einemAnfang steht (und nicht, wie hier, an einem Ende), und dann kommt das, worum es im Grunde geht. Doch wahrscheinlich ist es in diesem Gedicht genau so: ich vermute, daß Heißenbüttel das Ergebnis seiner neun Zeilen hinter das Gedicht verlegt hat. Dieses Ergebnis kann so oder so sein, es kann eine ganz bestimmte Antwort sein, es kann aber auch eine Frage sein, wobei mir durchaus nicht festzustehen scheint, was mehr wert ist, eine Frage oder eine Antwort. Heißenbüttel tut nicht so, als wüßte er das Ergebnis. Doch ich zweifele nicht daran, daß er es wittert. Er spricht in den Zeilen 1 bis 8 Inhalte aus, die, wie mich dünkt, voraussagen, daß dem viermaligen Ausruf in der 9. Zeile nichts Gutes folgt. Die Zeilen 1 bis 4 vermitteln folgendes: der Autor hört in haltlose Sätze, er hört wirkliche Gesprächsteile, er hört Stimmen über dem Eis, er sieht ein Gesicht, das er erkennt, obwohl es kein menschliches Gesicht ist. In der 5. bis 8. Zeile teilt der Autor etwas über die äußere Lage mit, in der er sich befindet: am Tag vor Weihnachten, genauer, in der Nacht vorher, ist die Landschaft vor lauter Nacht blau, die Mitte der Nacht ist erreicht, gleich wird sie zum Morgen umschlagen, sie eilt wie mit Flügeln dem Morgen zu. Ja, und was ist mit der „milchbraunen Kreisform“? Ist sie der Mond? Ist sie eine Abstraktion, immerhin eine „milchbraune“ Abstraktion, die alles andere zusammenfassen soll? Ich weiß es nicht.
Wie könnte ich es auch wissen, ich, der ich ein Leser bin wie jedermann? Sehen Sie, da treffen Sie schon auf das zweite Geheimnis in diesem Gedicht – das erste bestand darin, daß sein Schluß offenblieb –, und dabei gibt es Leute, die behaupten, die neuen Gedichte seien geheimnislos. Sicher stimmen Sie mit mir darin überein, daß diese Leute sich irren. Ich fürchte aber, die Geheimnisse im Gedicht Heißenbüttels weisen auf böse Gegebenheiten in der Gegenwart oder Zukunft hin, zumal wenn ich mich daran erinnere, daß in der 1. Zeile von „inhaltlosen Sätzen“ die Rede ist, daß die „Stimmen über dem Eis“ in der 3. Zeile unentzifferbar sind (denn wenn sie entzifferbar wären, hätte sich der Autor unzweifelhaft die Mühe gemacht, sie zu entziffern, und es wäre ihm wohl auch gelungen), wenn ich mich darauf besinne, daß das Gesicht in der 4. Zeile, dieses erkannte Gesicht, entleert und also unmenschlich ist. Und nun, nachdem dies alles erwähnt ist, die schrecklichen Einzelheiten, doch auch die schönen Einzelheiten – ist das Wort „Nachtblau“ nicht schön, ist „geflügelte Peripetie der Nacht“ nicht schön? Und dabei gibt es Leute, die behaupten, die neuen Gedichte seien nicht schön –, nun erscheint in der 9., der letzten, Zeile das vierfache „jetzt“, diese erschreckende Summe der vorhergehenden Zeilen 1 bis 8, dieser Schrei, möchte ich sagen, der eine Warnung sein kann, und der, zusätzlich, die Bitte des Autors an Sie, seine Leser, enthalten kann, daß Sie ihn darin unterstützen, aus den „inhaltlosen Sätzen“ inhaltsvolle Sätze zu machen, aus den unentzifferten „Stimmen über dem Eis“ entzifferbare und sogar entzifferte Stimmen, aus dem „menschenleeren Gesicht“ ein menschliches Antlitz.
Nach dieser gemeinsamen Expedition durch ein Gedicht Helmut Heißenbüttels wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn ich Sie jetzt allein ließe. Bestimmt haben mich viele von Ihnen überhaupt nicht gebraucht. Doch mag es, andrerseits, auch ein paar unter Ihnen gegeben haben, denen ich ein bißchen auf die Strümpfe geholfen habe. Diesen, und nur diesen, will ich noch eine Art Landkarte einhändigen, damit sie sich im Urwald der neuen Gedichte insgesamt einigermaßen zurechtfinden. Aber meine Karte wird fast ausschließlich aus Fragen bestehen. Und zwar aus folgenden Gründen: zum einen beeinflussen Fragen nicht so sehr wie Antworten, so daß Sie Ihre Einsichten mehr durch sich selbst als durch mich gewinnen können, und zum anderen wage ich es kaum, den so vielschichtigen Komplex der neuen Gedichte durch Feststellungen bloßzulegen, und zum dritten weiß ich nicht so recht, ob ich es überhaupt könnte.
Zunächst möchte ich Sie also fragen: was ist ein Gedicht? Doch schon fürchte ich, daß diese Frage falsch gestellt ist. Erschöpft sie sich nicht im Poetischen? Ist denn ein Gedicht allein? Oder befindet es sich nicht im Zustand der Kommunikation mit allem, was es umgibt? Wird es nicht von seiner Umgebung bestimmt, so, wie es seinerseits die Wirklichkeit bestimmt? Sollte mithin meine erste Frage nicht heißen: was ist, im Jahr 1959 und in diesem Land, ein Gedicht? Damit hängt die zweite Frage zusammen: sind Gedichte – Gedichte im Jahr 1959 und in diesem Land – nur einfach da, wie man es oft hören kann, oder sind sie nicht auch, und dies vielleicht vor allem, zu etwas da? Falls das aber so wäre, wozu sind sie da? Zur Verminderung des Bösen und somit zur Vermehrung des Guten? Ist es möglich, daß ihre Reime und Rhythmen die Gewalt der Gewaltlosigkeit gegen die Macht der offenkundigen und versteckten Mächte setzen? Können sich, vom andern Ende aus gefragt, unsere Gedichte überhaupt entziehen? Sind sie nicht Drehscheiben. In welche die Zustände, Begebenheiten und Gegenstände der Zeit und des Orts, unserer Zeit und unseres Orts, hineingefahren, und aus denen die Metaphern der Lyrik hinausgefahren werden, nachdem jene und diese sich miteinander vermischt haben? Darf ich in diesem Zusammenhang an Matthias Claudius erinnern, der vor hundertundfünfzig Jahren schrieb:
So legt euch denn, ihr Brüder,
in Gottes Namen nieder;
kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns Gott mit Strafen
und laß uns ruhig schlafen!
Und unsern kranken Nachbarn auch!
War der Nachbar des Claudius nicht ein anderer Nachbar als der des Peter Rühmkorf oder des Wolfdietrich Schnurre? Würde sich, andrerseits, Claudius, gerade er, wenn er heute lebte, der „Verwandlung von Brei in Brot, Brot in Wein und Wein in Gesang“ enthalten (Henry Miller)? Seit wann sind unsre Nachbarn, sind wir selbst, so anders geworden? Gab es nicht einen Augenblick – Augenblick, als poetisches und kollektives Sinnbild verstanden –, da eine Zeit der äußersten Situationen begann, eine Zeit also, die von der Zeit des Claudius, ja, von der des Richard Dehmel und Arno Holz, aufs äußerste verschieden war? Für mich geht es seit dem Augenblick, da Georg Heym im Jahr 1912 beim Schlittschuhlaufen im Berliner Wannsee ertrank, um das Sein oder Nicht-Sein von uns allen. Es ist anzunehmen, daß vielen von Ihnen andere Einschnitte, doch von derselben außerordentlichen Bedeutung, bewußt sind. Ich vermute aber, Ihre Kerben und mein Augenblick sind auf die Jahre 1910 bis 1914 konzentriert. Und so frage ich Sie und mich: befinden wir uns alle nicht seit diesem Jahrfünft in den äußersten Situationen von Männern, die erfahren haben, daß alles in Frage gestellt ist? Wir alle – und ausgerechnet unsere Lyriker nicht? Wie, sie könnten immer noch Gedichte schreiben, die wie „gemalte Fensterscheiben“ sind? Waren ihre – und ihre – Fensterscheiben nicht gestern noch zersplittert? Jetzt sind sie ja wohl meistens heil. Doch wie wird es morgen sein? Stecken also nicht die Lyriker, ihre Gedichte und Sie, die Leser dieser Gedichte, in ursächlichen, unlöslichen, ja, sich deckenden Zusammenhängen? Falls man so kühn ist die Dichter für die Stellvertreter der Propheten zu halten die in die Verschollenheit sanken, versteht es sich dann nicht von selbst, daß ihre Dichtungen, so frage ich weiter, sich nicht nur um die Ursachen kümmern, sondern auch – und sei es nur um einen einzigen cm – vor den künftigen Ereignissen her eilen? Ähneln sie also nicht gleichsam Aufnahmegeräten, auf deren Bänder Oberschall und Isotop ihre Stenogramme geritzt haben? Sind sie nicht enzyklopädisch und entsprechen damit nur – nur! – den Verschränkungen der Physik mit der Metaphysik und den Berührungen der Formeln Max Plancks und Albert Einsteins mit den Thesen John Henry Newmans und Karl Barths? Dies alles eingerechnet, können, ja, dürfen Sie, meine Damen und Herren, sich vor sogenannten experimentellen Gedichten scheuen? Können, ja, dürfen Sie bei kosmetischen Versen beharren wie ich mir jene Afterpoesie zu benennen gestatte, die sich an diesem Tag und an diesem Ort, auf Claudius oder Rainer Maria Rilke schminkt? Ich bin, und nun frage ich allerdings nicht mehr, sondern antworte unumwunden, für diejenigen neuen Gedichte, welche die Dichtung – und also den Menschen – vom Fleck befördern, aus der Bewegungslosigkeit, aus den überholten Ordnungen. Wollen Sie, bitteschön, in Postkutschen fahren? Ganz gewiß nicht. Verzichten Sie, bitte, auch in der Lyrik darauf.
Wolfgang Weyrauch, Nachwort
Beitrag zu diesem Buch:
Hans Bender: Über neue Anthologien zeitgenössischer Lyrik
Merkur, Heft, 162, August 1861
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + KLG + Archiv 1 & 2 +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
Nachruf auf Wolfgang Weyrauch: Die Zeit


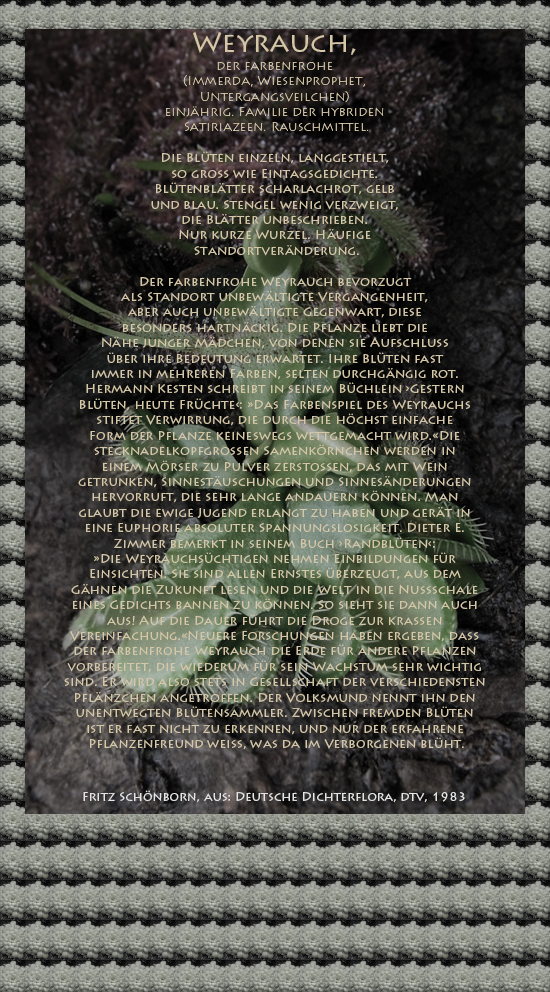












Schreibe einen Kommentar