Harald Hartung (Hrsg.): Jahrhundertgedächtnis
CITIZEN KANE
Lang war jeder Tag
aaund der Schnee
aaaadas Licht meines weichen Himmels
aaund die Kälte
aaaadas Blut meiner glühenden Haut
aaund das Spiel
aaaader Garten meiner tollwütigen Heiterkeit
Danach ist es nie Sommer geworden
aaJahre sind vergangen in zugigen Häusern
aaaanach den Uhren anderer
aaan Schreibtischen mit flüchtigen Papieren
mit falschen Wörtern in kaltem Zigarettenrauch
Manchmal noch nehme ich tastend
aadie Glaskugel auf und kehre
aaaastill für mich die Welt um
aameinen erfrorenen Erdball
aaaamein Winterauge
aaaablind vor Schnee
Karin Kiwus
Jahrhundertgedächtnis
Das Gedächtnis
Mnemosyne – Erinnerung, Gedächtnis – war den alten Griechen die Mutter der Musen. Und wenn auch die Musen im Laufe der Tradition zur mythologischen Staffage wurden – Erinnern, Eingedenken, Andenken blieben entscheidende Motive allen Dichtens. Hölderlin war vielleicht der letzte Dichter, der noch glaubwürdig von den Musen und von Mnemosyne sprechen konnte. Er, der „Dichter in dürftiger Zeit“, wagt in seiner späten Hymne „Andenken“ den Vers:
Was bleibet aber, stiften die Dichter.
Das mag bereits verzweifelte Hoffnung gewesen sein – Hoffen wider alle Hoffnung. Aber etwas von der Vorstellung, daß Poesie etwas aufbewahrt, was anders nicht zu bewahren ist, steckt in jedem, der heute noch Verse schreibt – und das sind erstaunlicherweise nicht wenige. So hält sich die Lyrik, dies quasi atavistische Medium, das uns an Ältestes, Uranfängliches erinnert, nicht bloß in der altbekannten Konkurrenz von Drama und Roman, sondern auch gegen die Attraktionen der jüngsten medialen Fazilitäten. Immer noch hat das Gedicht in unserem Bewußtsein einen Sonderstatus. Ein erfolgreicher Prosaautor, nämlich Martin Walser, hat sogar gemeint:
Ich glaube, es gibt keinen Schriftsteller, der nicht am liebsten Lyriker wäre.
Und wirklich: unter den großen Autoren deutscher Sprache, die im 20. Jahrhundert schrieben, sind erstaunlich viele Lyriker: George, Hofmannsthal, Rilke, Benn, Trakl, Brecht, Celan, um nur einige zu nennen.
Paul Celan, der seinen ersten reifen Gedichtband Mohn und Gedächtnis nannte, ist hier mein Zeuge in Sachen Mnemosyne. Jedem Gedicht sei sein „20. Jänner“ eingeschrieben, hat Celan mit Blick auf Büchners Lenz gesagt:
Es bleibt seiner Daten eingedenk, aber – es spricht.
Ein merkwürdiges Paradox! Eingedenken und dichten, durch solches „aber“ getrennt, scheinen sich auszuschließen, will sagen: das Gedicht spricht trotz seiner „Daten“. Celan mußte seine eigenen Daten nicht einmal nennen: sein „20. Jänner“ meint auch die Berliner Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942, auf der die Vernichtung der Juden beschlossen wurde. Celans Gedichte verschweigen solche Daten und bewahren sie zugleich. Sie sind tatsächlich Mohn und Gedächtnis: nämlich Lethe und Andenken zugleich. Jeder Leser dieser Lyrik weiß, was die nicht vernarbende „Erinnerungswunde“ meint, von der eines der Gedichte spricht: den Holocaust, die nicht zu vergessende Shoa.
Daß es barbarisch sei, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben – diesen Satz von 1951 hat Theodor W. Adorno zwar nicht widerrufen, aber doch revidiert. Er ließ später nicht nur Gedichte nach Auschwitz gelten, sondern auch solche über Auschwitz. Die Gedichte der Nelly Sachs vor Augen, schrieb Hans Magnus Enzensberger 1959, Adornos Verdikt müsse widerlegt werden, „wenn wir weiterleben wollen“. Nelly Sachs selbst hat das Rettende der Poesie so formuliert:
Die furchtbaren Ereignisse, die mich selbst an den Rand des Todes und in die Verdunkelung gebracht haben, sind meine Lehrmeister gewesen. Hätte ich nicht schreiben können, so hätte ich nicht überlebt.
Die Dichter also – und nicht der Philosoph – haben das überleben der Poesie gerechtfertigt. Sie rechtfertigen damit, so scheint mir, nicht bloß die Dichtung nach Auschwitz, sie lenken unseren Blick auch auf den Vorrat an Gedächtnis, der in der Poesie des gesamten Jahrhunderts angesammelt und aufbewahrt ist. Dort sind unsere „Daten“, um noch einmal Celans Begriff aufzunehmen. Dort sind Herkunft wie Zukunft. Denn das Gedicht er-innert nicht nur etwas, es öffnet sich auch und damit unser Bewußtsein. Es verweist den Leser auf seine eigenen Daten. Präzis und behutsam ist das in Celans rhetorischer Doppelfrage gefaßt:
Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben wir uns zu?
Das Jahrhundert
Aber was sind die Daten des Jahrhunderts? Das 20. Jahrhundert, so meint die ungarische Philosophin Agnes Heller in ihrem Essay „Requiem für ein Jahrhundert“, sei das Jahrhundert der Katastrophen – zwei Weltkriege, Holocaust, Gulag und Hiroshima:
Es hat das 19. Jh. gleichsam zurückgenommen so wie Adrian Leverkühn Beethovens IX. Symphonie.
Damit gibt Agnes Heller dem Säkulum einen symbolischen Gehalt und Charakter. Dann erhalten die einzelnen Daten, unabhängig vom Kalendarisch-Chronologischen, ihren Platz.
Auch diese Anthologie versteht das Jahrhundert nicht kalendermäßig. Sie tut das so wenig wie die Historiker, die sich darüber streiten, ob das 20. Jahrhundert schon mit dem persönlichen Regiment Wilhelms II. oder erst 1914, mit den Schüssen von Sarajewo, zu beginnen habe – ob also die Vorgeschichte der Katastrophe oder die Katastrophe selbst die Zäsur setzt. Mir scheint, auch die Vorzeichen gehören zum Vulkanausbruch. Wie die Nachbeben. Immerhin: Das Jahrhundert der Katastrophen besitzt einen provisorischen Schlußpunkt: das Datum 1989, den Kollaps des kommunistischen Systems.
Und die Daten der Poesie? Auch für die moderne Lyrik ist das Stichjahr 1900 kein Datum. Wer ihren Beginn fixieren möchte, müßte ein weiteres halbes Jahrhundert zurückgehen, zu ihren Gründervätern und Gründungstexten, also zu Walt Whitmans Leaves of Grass (1855) und Charles Baudelaires Les Fleurs du mal (1857). Von den beiden Sammlungen gingen die Hauptlinien der späteren Lyrikentwicklung aus. Von Baudelaire die artistische, hermetische, von Whitman die realistische, engagiert-politische Lyrik. Bertolt Brecht, der dies im Sinn hatte, unterschied eine pontifikale und eine plebejische Linie – für die erste stand ihm Stefan George, für die zweite er selbst. Aber mit solch groben Filiationen ist wenig gewonnen. Die Poesie entwickelt sich in Verästelungen, in Nuancen. Ihre Fülle liegt in der Vielfalt des Individuellen, in der Ausdifferenzierung der Themen und der Töne.
Wo also beginnt die deutschsprachige lyrische Moderne – und damit unsere Lyrik des 20. Jahrhunderts? Wir können ihren Beginn etwa mit Stefan Georges Reise nach Paris datieren (1889), als der Einundzwanzigjährige die Lyriker Stephané Mallarmé und Paul Verlaine kennenlernt. Oder aber, etwa gleichzeitig, mit dem Einsetzen der Wirkung Friedrich Nietzsches, dessen „Gott ist tot“ über dem Eingang zu den Schrecken des 20. Jahrhunderts steht. Nietzsches Begriff der Artistik ist für Lyriker wie Gottfried Benn ausschlaggebend geworden und hat noch auf die poetologischen Diskussionen der Jahre nach 1945 eingewirkt. Und am eigentlichen Jahrhundertanfang, in Nietzsches Todesjahr 1900, hat der erwähnte George der Selbstbezichtigung Nietzsches („Nur Narr, nur Dichter“) sein Votum „Sie hätte singen / Nicht reden sollen diese neue seele“ entgegengesetzt.
Nun gibt es gewiß Gründe, von einer zweiten Lyrik-Revolution zu reden, die gegen 1910 einsetzt, also vom Futurismus, Imagismus, Akmeismus in Italien, England und Rußland, oder eben vom deutschen Expressionismus. Expressionismus – das ist ein merkwürdiges Nebeneinander von Endzeit- und Aufbruchstimmung. Für die befürchtete Apokalypse etwa steht Jakob van Hoddis’ groteskes Gedicht „Weltende“ (1911), für den erhofften Befreiungsimpuls Ernst Stadlers Band Der Aufbruch (1914). 1916, auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs, kommt es zur Klimax dieser expressionistischen Revolte. Vom Cabaret Voltaire in der Züricher Spiegelgasse geht der Dadaismus aus, und die Ironie der Geschichte will, daß in der nämlichen Spiegelgasse Herr Uljanow-Lenin wohnt, der im folgenden Frühjahr nach Petersburg reist, um die sowjetische Revolution zu machen.
Ich erwähne das als Beleg dafür, daß von nun an die Geschichte dominiert, daß die Poesie keine Zeitüberlegenheit mehr zu gewinnen weiß. Sie gerät in die Defensive, und ihr zarter Widerstand ist ihr Ruhmesblatt. Wo sie zu führen meint, biedert sie sich den Führenden bloß an, betreibt sie Affirmation und Verrat. Somit wird es immer fraglicher, ob Stilbegriffe und Ismen geeignet sind, die lyrische Entwicklung zu gliedern. Natürlich erzeugt der Literaturbetrieb aus begreiflichem Eigeninteresse den Eindruck von Bewegung, ja von Beschleunigung der Abfolge von Schulen und Stilen. Vielleicht ist das aber nur ein rasender Stillstand. Hugo Friedrich hat schon 1956, in seiner Struktur der modernen Lyrik, den Verdacht geäußert:
Fundamental Neues bringt die Lyrik des 20. Jahrhunderts nicht mehr, so qualitätvoll auch einige ihrer Dichter sind.
Das war in einer Situation gesprochen, in der ein geschichts- und kunstphilosophischer Optimismus den Begriff der „Avantgarde“ hypostasierte, den Fortschrittsglauben in den Künsten, etwa die Vorstellung, es gebe in der Lyrik so etwas wie Fortschritte der „Materialbeherrschung“. Von den Avantgarden, die sich als solche selbst ausriefen, blieben einzig jene Texte, die sich ohne theoretisches Stützkorsett haben halten können. Hans Magnus Enzensberger schrieb seinerzeit, nämlich 1962 in Die Aporien der Avantgarde:
Jede heutige Avantgarde ist Wiederholung, Betrug oder Selbstbetrug.
Das soll nun nicht heißen, daß es keine Veränderung gibt, keine Entwicklung und Modifikation. Aber Stile oder Seilepochen sind nicht mehr prägend oder gar verbindlich. Es gibt keine historische Konsequenz der stilistischen Entwicklung, sondern zunehmend das Nebeneinander von persönlichen Optionen. Man kann das mit dem Begriff Postmoderne zusammenbringen. „Anything goes“ ist eines ihrer Motti; aber dieses „Gehen“ ist oft nichts als eine Scheinbewegung. Schon sehr früh, nämlich anfangs der sechziger Jahre hat Arnold Gehlen diesen Kulturzustand, der alle seine eigenen Möglichkeiten entwickelt und dazu sämtliche Alternativen bereitstellt, als „Kristallisation“ bezeichnet. Doch auch diese Diagnose soll uns nicht schrecken. Wenn auch die großen Attitüden verbraucht sind: selbst der Synkretismus der Stile und Möglichkeiten vermag Faszinierendes hervorzubringen.
Man kann heute noch einen Schritt weitergehen und sagen: Das (fast) abgelaufene Jahrhundert zeigt in seinen diversen Richtungsetikettierungen schon früh eine Unübersichtlichkeit, ein Nebeneinander der Strebungen. So schon um 1900, als Begriffe wie Impressionismus, Symbolismus, Neuromantik, Jugendstil nebeneinander bestanden oder ineinander übergingen. Auch der Expressionismus brachte, bei aller Stärke des Gesamtimpulses, durchaus Heterogenes und Unvereinbares, wie schon Gottfried Benn bemerkte. Dadaismus und Surrealismus wurden eher abgebrochen als weiterentwickelt. Neue Sachlichkeit und neuer Klassizismus waren nicht bloß stilistische, sondern auch untergründig politische Optionen; nicht zuletzt im Zeichen des aufkommenden Faschismus. Literarisch war eher das Jahr 1930 als die Machtergreifung Hitlers eine Zäsur, und die Rückkehr zu festen Formen, die zur Bewahrung der Werte zu dienen schien, konnte unter völlig entgegengesetzten Auspizien geschehen. Man denke an die Beliebtheit der Sonett-Form bei den Emigranten wie bei den Vertretern einer sogenannten inneren Emigration. Auch die lyrische Nachkriegsentwicklung teilt sich nur notdürftig in Schulen wie Naturlyrik, Hermetik, konkrete Poesie, Polit- oder Poplyrik. Im Rückblick aber ist ganz offenkundig, wie die letztgenannten Schulen etwa zur westdeutschen Literatur vor bzw. nach dem Mauerbau gehören.
Kurz: Mir erschien es richtig, das lyrische Material in dieser Anthologie historisch zu gliedern; nicht strikt in der Folge der Jahre, sondern nach Epochenabschnitten, die lebensmäßig als Einheiten verstanden, nämlich erlebt und erinnert werden. Zu dieser jeweiligen Zeitgenossenschaft gehört das Konzert von Stimmen, die nach Alter, Herkunft, Temperament und Stil differieren. Während der junge Georg Heym, selbst im poetischen Aufbruch, das „überschminkte Frauenzimmer Maria Rilke“ verspottete und den „schwachen Kadaver eines Stefan George“ schmähte, schrieb er Gedichte, die jede persönliche Polemik vergessen lassen. Ein anderes Beispiel, eher von der Epoche her gesehen: Daß Karl Kraus und der damals ganz junge Günter Eich zu den zwanziger Jahren gehören und nicht bloß Brecht oder Kästner, scheint mir für das lyrische Bild dieser Epoche nicht ohne Bedeutung. Aber natürlich kann man nun fragen: wann enden diese zwanziger Jahre? Mit dem schwarzen Freitag vom Oktober 1929 oder mit dem Reichstagsbrand? Die Kapitel der Anthologie möchten zu solchen Fragen anregen. Sie sind jeweils nach den Geburtsjahren der Autoren angeordnet und bringen also Differenzen, Sprünge, Dissonanzen, aber, so scheint mir, auch frappierende Übergänge und Bestätigungen.
Noch einmal Paul Celan:
Denn das Gedicht ist nicht zeitlos. Gewiß, es erhebt einen Unendlichkeitsanspruch, es sucht durch die Zeit hindurchzugreifen – durch sie hindurch, nicht über sie hinweg.
Man könnte das als Explikation eines etwas geheimnisvollen Goethe-Satzes auffassen, der lautet:
Die höchste Lyrik ist entschieden historisch.
Die Anthologie
Über den Nutzen von Anthologien ist immer schon gestritten worden. Ihrer Beliebtheit hat das keinen Abbruch getan. Leute, die sonst keine Lyrik lesen, blättern doch gelegentlich in Anthologien; und jeder Lyrikleser wird die Erfahrung gemacht haben, durch eine Anthologie auf bestimmte Dichter erst aufmerksam geworden zu sein oder eine Thematik oder eine Epoche in ihrer Besonderheit begriffen zu haben. Auch „Blütenlesen“, denn das sind Anthologien, sind nicht für die Ewigkeit. Was sie zu konservieren scheinen welkt wie alles andere. Aber wie viele Poeten, deren Gesamtwerk verstaubt und vergessen ist, leben mit einzelnen Gedichten in Anthologien fort – vielleicht gar von Anthologie zu Anthologie fortgetragen. Anthologien bauen am Kanon mit, aber sie selbst sind nicht kanonisch. Manche erlangen eine kleine Unsterblichkeit als historische Exempel. So Kurt Pinthus‘ berühmte Menschheitsdämmerung, die im Herbst 1919 erschien und das Phänomen Expressionismus im Moment seiner Vollendung genial erfaßte und, im Hegelschen Doppelsinn, aufhob.
Auch Rudolf Borchardts kanonisch gedachter, hochgemuter und etwas hochmütiger Ewiger Vorrat deutscher Poesie von 1926 überlebt als Dokument. Andererseits wirken selbst anti-kanonisch gedachte Sammlungen an der Kanonbildung mit; so etwa die 1973 von Helmut Heißenbüttel und Franz Mon edierte Antianthologie, mit dem Untertitel „Gedichte in deutscher Sprache nach der Zahl ihrer Wörter geordnet“: Sie lenkte den Blick fort von Autor und Thematik auf die pure Existenz und Quantität des einzelnen Gedichts. Daß es nützlich sein konnte auf den Text und nicht auf den Namen des Verfassers zu schauen, hatte schon 1956 Walter Höllerers Transit, ein „Lyrikbuch der Jahrhundertmitte“, zeigen wollen. Was also bleibt? Der Anthologist kann nur sagen und hoffen:
Das bleibt.
So sagt es jedenfalls der Titel einer Anthologie von Jörg Drews, bei dem man ein (ironisches?) Ausrufzeichen mitdenken darf.
Die beste Verteidigung des Nutzens von Anthologien sehe ich in einer Formulierung Bertolt Brechts:
Jedes Gedicht ist der Feind jedes andern Gedichts und sollte also allein herausgegeben werden. Gleichzeitig benötigen sie einander, ziehen Kraft auseinander und können also vereint werden.
Brecht formulierte das in eigener Sache, aus Anlaß der Herausgabe seiner Hundert Gedichte, aber trifft damit den Sinn von Anthologien. Auch wenn er abschließend schreibt:
Man sollte den Leser zum Blättern bringen.
Die Auswahl
Jede Auswahl ist subjektiv. Dazu muß sich der Anthologist bekennen. Oder – nach einer Formulierung Adolf Muschgs – das Persönliche der Auswahl dient nicht der Entschuldigung, sondern zur Legitimation. Meine Auswahl ist die eines Lyrikers und Kritikers der sich auf seine Leseerfahrung, seine Liebe zum Gedicht beruft. An deren Anfang war übrigens eine Anthologie, ein Heftchen eigentlich nur, betitelt Der Regenbogen, herausgegeben, wenn ich nicht irre, von der britischen Militärbehörde zu Zwecken der Reeducation. Ich kaufte es mir als Schüler. Einige Gedichte, die ich damals las, stehen jetzt hier in Jahrhundertgedächtnis.
Es gibt einen Satz, mit dem sich jeder Anthologist auseinandersetzen muß: Gottfried Benns Behauptung, wonach keiner der großen Lyriker mehr als sechs bis acht vollendete Gedichte hinterlassen habe: „Die übrigen“, meint Benn, „mögen interessant sein unter dem Gesichtspunkt des Biographischen und Entwicklungsmäßigen des Autors, aber in sich ruhend, aus sich leuchtend, voll langer Faszination sind nur wenige.“
Dagegen läßt sich einiges vorbringen. Erstens werden sich Kenner und Liebhaber eines Dichters kaum auf sechs oder acht Stücke einigen können. Wo zwei oder drei Lyrikfreunde zusammenkommen, dürfte zumindest ein gutes Dutzend Gedichte zur Debatte stehen. Es wäre also ein leichtes gewesen, die Auswahl von Gedichten Georges, Hofmannsthals, Rilkes, Else Lasker-Schülers, Benns, Brechts und Celans um etliche Stücke zu erweitern.
Mit Benns Rigorismus läßt sich keine Anthologie machen. Ihm zu folgen wäre ungerecht auch gegen jene Dichter, die solche Gedichte – „in sich ruhend, aus sich leuchtend, voll langer Faszination“ – nicht geschrieben haben, ja vielleicht nicht einmal schreiben wollten. Doch von ihnen gibt es solche Gedichte, die uns nachgehen, beschäftigen, irritieren, obwohl die eine oder andere Zeile nicht „vollkommen“ ist. Im übrigen könnte man Benns Vollkommenheitsästhetik eine Gebrauchsästhetik entgegensetzen. Etwa mit Enzensberger, der sagt:
Die Vorstellung, daß Gedichte besonders edle oder schonungsbedürftige Gegenstände seien, ist schädlich. Sie gehören nicht unter Glasstürze und Vitrinen. Gute Gedichte haben eine lange Lebensdauer und können einen gewissen Grad von Ehrwürdigkeit erlangen.
Nun ist auch der Gebrauchswert eines Gedichts so wenig bestimmbar wie sein Kunstwert. Bestimmen läßt sich aber durchaus, was man nicht bringen will. Ich sage also, worauf ich in dieser Anthologie verzichte:
– Zunächst auf das, was zwar in Versen geschrieben ist, aber primär erzählenden, belehrenden oder rhetorischen Charakter hat. Es fehlen also Balladen, Sprüche oder humoristische, satirische, agitatorische Verstexte.
– Es fehlt auch weitgehend jene Lyrik, die traditionelle Gemüts- und Stimmungswerte thematisiert: Jahrhundertgedächtnis ist kein bürgerliches Hausbuch.
– Andererseits ist diese Anthologie kein Musterbuch literarischer Experimente; keine Sammlung von Texten (das wäre dann auch der richtige Ausdruck), die vor allem ihrer technischen Verfahren, ihres experimentellen Anspruchs wegen faszinieren und ein spezielles Interesse bedienen.
– Schließlich will die Anthologie keine literar- und zeithistorische Dokumentation sein. Sie verzichtet also – zumeist schon aus Qualitätsgründen – auf die affirmativen Texte von Autoren, die sich faschistisch oder stalinistisch encanaillierten.
Nun aber stecken Gott oder Teufel wie immer im Detail. So auch bei dieser Auswahl. Dafür ein paar Beispiele. Paul Celan etwa hat seine „Todesfuge“ später „lesebuchreif gedroschen“ gefunden – jedoch niemals widerrufen. Sollte man also auf dieses Gedicht verzichten, weil einige Kritiker in ihm eine Ästhetisierung des Bösen sahen und nicht das Jahrhundertgedicht, das sie ist? Wer die „Todesfuge“ verstanden hat, wird auch für die „grauere Sprache“ von Celans „Engführung“ und für seine späte Lyrik vorbereitet sein. Im übrigen bringe ich auch dafür Beispiele.
Je mehr sich die Anthologie der Gegenwart nähert, um so schwieriger und heikler wird die Auswahl. Auch hier ging es mir nicht um die Sammlung bekannter Namen, sondern um das einzelne Gedicht – um Gedichte, die mich in den letzten Jahrzehnten begleitet haben oder um andere, jüngere, jüngste, denen ich zutraue, daß sie über die Jahrhundertwende haltbar bleiben.
Jede Auslese wird um so schwieriger, je mehr man sich dem Heute nähert. So konnte es nicht ausbleiben daß die Kapitel der Anthologie zur Gegenwart hin umfangreicher werden. Sie waren ursprünglich noch fülliger gedacht, doch mußte der Proportion – also auch der Gerechtigkeit – geopfert werden. Es fehlen daher schätzenswerte und namhafte Gegenwartsautoren, die mir ihre Nichtaufnahme nachsehen mögen. Auf der anderen Seite wird der Leser auch Gedichte von Poeten finden, die wenig bekannt, ja verschollen sind. Das Dargebotene muß für sich selbst sprechen.
Überhaupt kommt man, je länger man sich mit Lyrik beschäftigt und über sie nachdenkt, an den Punkt, an dem man immer weniger Sicheres zu sagen weiß. Günter Kunert hat gemeint, wir müßten uns damit abfinden, daß wir etwas Definitives über das Gedicht kaum zu erfahren vermögen:
Ich wage sogar die Behauptung, daß die Unmöglichkeit einer vollständigen Aufhellung des Sachverhalts ,Gedicht‘ seine Fortdauer überhaupt bewirkt.
Dennoch, zum Schluß, der Versuch, einem möglichen Mißverständnis zu begegnen. Nach all dem, was ich über Gedächtnis und Jahrhundert gesagt habe, könnte man vielleicht meinen, ich hätte die Gedichte vor allem nach ihrer historischen Aussage oder ihrer Zugehörigkeit zum ferneren oder engeren Bereich des Engagements ausgewählt. Nichts wäre falscher.
Mit Adorno halte ich die Trennung in reine und engagierte Lyrik für problematisch. Gerade die reine Lyrik, die der Gesellschaft nicht nach dem Mund redet, sagt uns Entscheidendes über den Stand von Gesellschaft. Man kann das schöner noch mit den Worten eines Dichters sagen. Um so eher, als dieser nicht im Verdacht steht, die Sache des Gedichts politisch zu verharmlosen. Bertolt Brecht schreibt einmal:
Aber dann gibt es noch andere Gedichte, die etwa einen Regentag schildern oder ein Tulpenfeld, und die lesend oder hörend verfällt man in die Stimmung, welche durch Regentage oder Tulpenfelder hervorgerufen wird, d.h. selbst wenn man Regentage oder Tulpenfelder ohne Stimmung betrachtet, gerät man durch die Gedichte in diese Stimmungen. Damit ist man aber ein besserer Mensch geworden, ein genußfähigerer, feiner empfindender Mensch, und dies wird sich wohl irgendwie und irgendwann und irgendwo zeigen.
Harald Hartung, Nachwort
„Das Jahrhundert ist vorgerückt,
jeder Einzelne aber fängt doch von vorne an“ – so weit eine Weisheit Goethes, die auch am Ende des 20. Jahrhunderts ihre Gültigkeit nicht verloren hat. Dennoch: auch jenem besagten „Einzelnen“ kann das z.B. in Büchern deponierte kulturelle Gedächtnis bei seinem Von-vorne-Anfangen zweifellos helfen. Und gerade das zur Neige gehende Jahrhundert war so überfüllt, zerrissen, beschleunigt, daß es geraten erscheint, sich seiner erinnernd zu vergewissern. Was z.B. auch in der Abstraktion oder punktuellen Plastizität lyrischer Texte geschehen kann.
Harald Hartung – Wissenschaftler, Rezensent, aber auch selbst Lyriker – hat kenntnisreich komponierend eine Anthologie deutschsprachiger Gedichte zusammengestellt, der es gelingt, ein nuanchenreiches Bild des 20. Jahrhunderts zu entwerfen – dem Jahrhundert zum Gedächtnis, uns „Einzelnem“ zum Nutzen.
Philipp Reclam jun. Stuttgart, Klappentext, 1998
Der Germanist Jörg Drews
ist eine Autorität seines Fachs. Er ist auch autoritär. Er hat den Deutschsprachigen diktiert, „was bleibt“ von deutschsprachiger Dichtung des Jahrhunderts. Wenn uns alle längst das Zeitliche gesegnet hat, wird die Zeit entschieden haben, was wirklich geblieben ist. Drews preschte mit seiner Jahrhundertübersicht der Lyrik vor und wird nun von Dutzenden Jahrhundert-Anthologien bombardiert werden. Auch nicht unbescheiden, offeriert Reclam Stuttgart den Band das Jahrhundertgedächtnis, der „Deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert“ vor allem den Gebildeten empfiehlt.
Reclam holte sich Harald Hartung als Herausgeber. Auch kein unbeschriebenes Blatt. Auch eine Koryphäe. Als Rezensent der Literatur, als Lyriker. Hartung ist nicht so gnadenlos wie Kollege Drews. Hartung ist Experimental-Lyrik weit weniger wichtig. Er legt Wert auf Entwicklungslinien der Lyrik, das heißt auf die geistige Linie, die er sieht. Das bedeutet, auf das hinzuweisen, was als Ausdruck der Zeit für die Zeit gilt und über die Zeiten hinaus Auskunft sein kann. Damit hat Hartung seine Sammlung vor jeder Beliebigkeit bewahrt. Wenn schon nicht Blut und Tränen, so muß das Kompendium den Herausgeber genug Schweiß gekostet haben. Der geistige Gehalt der Gedichte des Jahrhunderts, die Hartung vorstellt, ist das Ergebnis des Gehabten, Gewesenen, Gewachsenen. Folgerichtig beginnt der Band mit jenen, die schon vor dem Beginn des Jahrhunderts da waren. Nietzsche und Holz, Dehmel und George, Else Lasker-Schüler, von Hofmannsthal und Rilke. Die Aufnahme in die Anthologie war nicht nur dadurch garantiert, daß sie für einen gleitenden Übergang sorgen. Welche Linie, die nicht ihre Übergänge hat? Die Übergänge sichtbar zu halten ist dem Herausgeber erst schwer geworden, als er sich mit der deutschen Lyrik der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu beschäftigen hatte. Bei Hartung gibt es keinen Czechowski, keinen Greßmann, keinen Leising, keinen Papenfuß. Näher sind ihm Hahn, Haufs, Kiwus, von Petersdorf. Das west-deutsche Umfeld, in dem auch Hartung wuchs, ist genauer beachtet und bedacht worden als das ost-deutsche. Also ein Jahrhundertgedächtnis mit Erinnerungslücken? Wie an etwas erinnern, was kein Erlebnis und somit keine Erfahrung war? Auch eine Anthologie ist nur so gut wie ihre Auslassungen. Harald Hartung hat sich mit der angebotenen Ausgabe auf Zu- und Widerspruch eingelassen. Gut so!
Bernd Heimberger, luise-berlin.de, 1999
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Antrittsrede + KLG +
Kalliope + DAS&D + Johann-Heinrich-Merck-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口


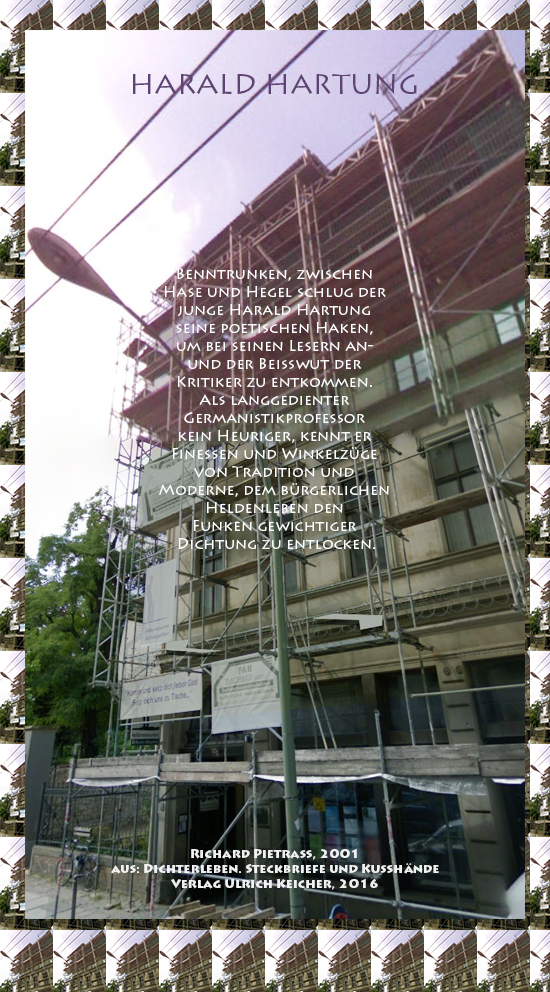












Schreibe einen Kommentar